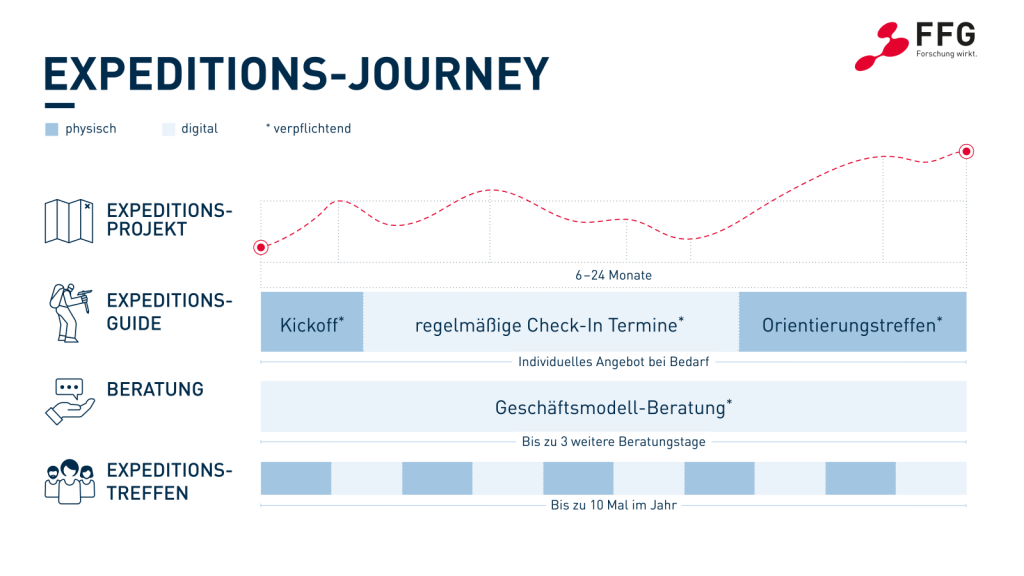✨ AI Kontextualisierung
“Chatarmin-Founder-Posting offenbart unterschiedliche Fronten der heimischen Startup-Szene” ist weder eine gute Schlagzeile, noch ein besonders schöner Satz. Trifft aber den Kern des Diskurses, der sich nach einem LinkedIn-Posting von Chatarmin-Gründer Johannes Mansbart zugetragen hatte. Seine emotional angehauchten Worte auf der sozialen Plattform und die Reaktionen darauf deuten eine zwiegespaltene Startup-Szene an, wenn es um New-Work-Entwicklungen geht.
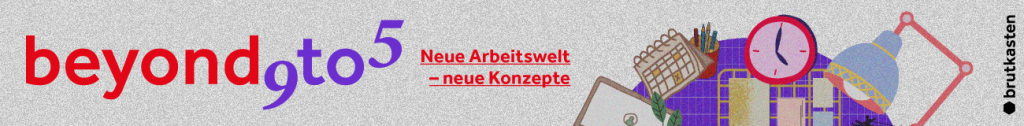
“Die absurde Leistung unserer Eltern und Großeltern nach dem Krieg rechtfertigt keine Wohlstandsverwahrlosung, dank derer wir Jungen jetzt in gesellschaftlicher Paralyse Potenzialanalysen und Gap Years machen, bis wir darauf kommen, dass wir mit den 1.000 Karrierewegen so überfordert sind, dass wir lieber direkt nochmal neun Monate Burnout-Klinik machen. Und uns dabei gegenseitig noch zujubeln”, schreibt Mansbart auf LinkedIn und erntet dafür von User:innen Lob, aber auch Kritik, die ihm u.a. “Bull**** und Shaming von psychischen Problemen” vorwerfen.
“Ich war selber knapp am Burnout (probably im Burnout) und kann daher aus Erfahrung sprechen”, reagiert der Chatarmin-Founder auf den Vorwurf. “Burnout ist meiner Meinung nach eine Krankheit, die es sowohl zu heilen, als auch präventiv zu verhindern gilt. Diese Verantwortung liegt einzig alleine in der kontrollierbaren Sphäre des Individuums, das selber darüber die Entscheidungsmacht innehat.”
Mansbart: “Ist man ein Bösewicht, wenn man gegen Grundeinkommen ist?”
In einem weiteren Punkt, den der Founder beschreibt, wehrt er sich gegen ein Anti-Leistungs-Prinzip, das seinem Gefühl nach aktuell vorherrscht. Und er stellt die Frage, ob man der Bösewicht ist, wenn man sich gegen das bedingungslose Grundeinkommen ausspricht.
In seinen LinkedIn-Worten klingt das so: “Ich verstehe den Wirbel echt nicht. Von nichts kommt nichts. Und der, der sich für Arbeit und Leistung ausspricht, und gegen noch sattere bedingungslose Grundgehälter, die uns noch wettbewerbsunfähiger machen, weil keiner mehr was arbeitet und riskiert. Der ist dann der Buhmann?”
Und weiter: “Jeder soll machen, was er will. ABER wenn ich in Einstellungsgesprächen und hier auf LinkedIn nur mehr von Menstruationstagen, Frauenquoten, 4-Tage-Wochen und Obstkörben, Company-Retreats und Yoga + Physio-Therapie Sessions als “Corporate Benefits” lese, wunderts mich nicht, dass wir längst unterdigitalisiert und wettbewerbsunfähig sind. Ich kenne keinen brillanten und erfolgreichen Gründer, der nicht diese positive Obsessivität hat. Ich kenne keinen richtig erfolgreichen Unternehmer, der nicht richtig, richtig, richtig hart dafür gearbeitet hat.”
Auf diese harten Worte angesprochen erklärt Mansbart dem brutkasten seine Befürchtungen und Bedenken, die er tagtäglich beobachtet. Konkret meint er, rein auf die “Startup-Bubble” bezogen, dass Förderungen Startups faul und träge machen und sie dadurch nicht wirklich den Product-/Market-Fit finden müssten. Und dass Fundingrunden und Headcount als ‘Erfolg’ tituliert werden. Was Jungunternehmen allerdings bräuchten, seien zahlende Kunden für ein funktionierendes Produkt. Alles andere sei seiner Einstellung nach ‘Noise’.
Auch hält er das bedingungslose Einkommen für nicht nachhaltig, da es den Menschen ebenso faul mache und “Incentives” schaffe, die Interessenskonflikte zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber fördern würden, anstatt sie zu beseitigen.
Beispiele gegen den “Faul-Vorwurf”
Studien und Pilotprojekte haben jedoch gezeigt, dass es durchaus gesellschaftlich positive Effekte gibt. Der Spiegel berichtete von einem Versuchsmodell in Finnland, wo ersichtlich wurde, dass die Bezieher eines Grundeinkommens weniger gesundheitliche Probleme und Stresssymptome hatten als die Menschen in der Vergleichsgruppe – vor allem Depressionen seien zurückgegangen. Eine andere Bezieherin erzählte davon, dass sie durch das Grundeinkommen den Weg in die Selbstständigkeit wagen konnte. Und heute ein Cafe in Helsinki führt.
Auch der Bayrische Rundfunk beschrieb im Juni des heurigen Jahres eine seit zwei Jahren laufende Studie. Hierbei handelt es sich um eine Zwischenbilanz der Ergebnisse, denn die Organisatoren der Untersuchung – der Verein “Mein Grundeinkommen” – wollten die Ergebnisse durch eine verfrühte Publikmachung nicht verfälschen. Bemerkenswert ist aber auch hier, dass eine Grundeinkommensbezieherin ihr Studium abbrach, um arbeiten zu gehen, weil ihr das bedingungslose Grundeinkommen “eine gewisse Sicherheit und die Möglichkeit, in Ruhe eine gute Stelle zu suchen”, ermöglicht hatte.
Seitens der LinkedIn-Community gibt es zu diesen Punkten unterschiedliche Auffassungen – von Zustimmung bis Unverständnis – wobei Mansbart nach einem kritischen Kommentar ihm gegenüber auch etwas zurückrudert:
“(…) Dass körperliche Arbeit noch einmal ein ganz anderes Life-Management benötigt, als Schreibtisch-Arbeit, ist doch auch völlig klar. Dass ‘mit vollen Hosen gut stinken ist’ und ich als junger veranwortungsloser Selbständiger ganz andere Lebensbedingungen habe, ist doch sonnenklar“, stellt der Gründer richtig, als ihm ein User vorwirft, er würde nur an die “Fantasieberufe aus der eigenen Bubble” denken, und nicht an Bauarbeiter:innen oder Pfleger:innen, die in Schichtdiensten körperlich emotional richtig anstrengende Arbeit verrichten.
“Kann Gerede von 4-Tage-Woche nicht mehr hören”
Weitere LinkedIn-Worte von Mansbart thematisieren die Forderung der 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance. Und offenbaren eine kritische Geisteshaltung gegenüber den Wünschen von Angestellten, die sie von einem guten Unternehmen 2023 erwarten. Und immer mehr fordern.
“Ich kann das Gerede von 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance nicht mehr hören. Auch der ‘degressive Grenznutzen, über den ich nicht darüber hinaus arbeiten darf’ ist völliger Schwachsinn. So geht Unternehmertum nicht. Ich habe keine Ahnung, wer solche Ideen der jungen Gründer-Generation als erstrebenswert verkauft. Die ganzen Konkurse statt Exits sind die logische Konsequenz. Wer hat uns das kollektiv eingeimpft, dass Verdienst ohne Leistung eine gute Idee ist? Wo kommt das Gedankengut her, dass wir den Staat weiter überschulden, damit die Leute weniger arbeiten können? Und umgekehrt? A-B-S-U-R-D”, lässt der Founder seinem Frust freien Lauf auf LinkedIn. “Warum wird Arbeit so negativ behaftet? Darf hier keiner mehr erfolgreich sein, für das brennen, das er tut, und dann auch zeigen, was er hat?”
Auch hier muss man die Einstellung des Chatarmin-Founders differenzierter und seine Kritik an der 4-Tage-Woche und Co. mit der nötigen stoischen Ruhen angehen, um sich der Thematik ohne emotionale Ausbrüche zu nähern. Um sie besser zu erfassen.
“Schwindlige Studien”
Auch wenn manche in dieser Work-Debatte von “schwindligen Studien” reden, wie etwa Kurt Egger, ÖVP-Wirtschaftsbund-Generalsekretär, gab es bereits Untersuchungen, die positive Effekte bescheinigen.
Eine von der Non-Profit-Initiative “4 Day Week Global” in Auftrag gegebene Studie untersuchte nämlich 33 Unternehmen in den USA, Australien, Irland, Großbritannien, Neuseeland und Kanada. Diese haben für sechs Monate die Vier-Tage-Woche getestet. Die knapp 1.000 Angestellten der Unternehmen arbeiteten ohne Einkommensverlust statt 40 nur mehr 32 Stunden pro Woche.
Das Ergebnis zeigte, dass die Krankenstandstage pro Angestellten pro Monat sanken von durchschnittlich 0,56 auf 0,37. Generell haben sich auch die teilnehmenden Unternehmen sehr zufrieden mit dem Versuch gezeigt – etwa bei der Auswirkung auf die Produktivität bewerteten sie im Schnitt mit 7,6 – bei einer Skala von 0 (sehr negativ) bis 10 (sehr positiv). Bei einigen Unternehmen war die Produktivität während der Testphase sogar gestiegen.
Außerdem gab knapp die Hälfte der Belegschaft (44 Prozent) an, dass ihre Zufriedenheit im Beruf durch das Projekt gestiegen sei. Für 27 Prozent verschlechterte sich hingegen ihre Beziehung zum Arbeitsplatz. Positiv merkten 60 Prozent der Angestellten an, dass sich ihre Work-Life-Balance verbessert hätte.
Andere funktionierende Beispiele der 4-Tage-Woche findet man bei TeamEcho oder auch Tractive.
“Wir waren von Anfang an der Meinung, dass die 35 Stunden-Woche in etwa die gleiche Produktivität liefern wird, wie das Arbeitszeit-Modell davor”, sagte TeamEcho-Founder Markus Koblmüller damals gegenüber dem brutkasten. “Als Startup mit jährlichen Wachstumszielen im zwei- bis dreistelligen Prozentbereich, ist es jetzt schwer zu beurteilen, ob sich deswegen Vor- und Nachteile beim ‘Growth’ ergeben haben; gefühlt kann ich aber sagen, dass es insgesamt keine negativen Auswirkungen gab. Auch keine großen positiven. Jedoch zeigte sich, dass die Mitarbeiterzufriedenheit ein großer Vorteil wurde. Und ‘overall’ bei allen Aspekten, inklusive Motivation und Produktivität, eine positive Einschätzung seitens der Befragten herrschte.”
Bei Tractive gab es nach der Einführung der 4-Tage-Woche indes eine drastisch Erhöhung der Anzahl der Bewerbungen, sowohl von lokalen als auch von internationalen Talenten. Im zweiten Halbjahr 2022 erreichten das Tracking-Startup etwa dreimal so viele Bewerbungen wie im ersten Halbjahr, berichtete Founder Michael Hurnaus.
Benefits und Branding: Muss sich ein Unternehmen bemühen?
Mit diesen Beispielen im Kontrast zu Mansbarts Posting und oben beschrieben Reaktionen darauf aus den LinkedIn-Kommentaren zeigt sich, dass, obwohl der New-Work-Diskurs bereits länger besteht, trotzdem noch starke Ideologien zur heranschreitenden neuen Arbeitswelt existieren. Und von Front zu Front – mal mehr, mal weniger inhaltsleer – widergegeben werden.
Was mitunter ebenso an dieser Stelle mitschwingt, ist die Notwendigkeit des neuen Credos, dass sich heute und im Zuge des Fachkräftemangels ein Arbeitnehmermarkt statt eines bisherigen Arbeitgebermarktes herauskristallisiert hat, wie auch Annina Haslinger-Galipeau hier beschreibt. Und die abwehrende Haltung mancher, die diese Entwicklung mitbringt. Stichworte und im Fokus der Kritik dabei: Employer Branding und Mitarbeiter:innen-Benefits.
Wie brutkasten herausgefunden hat, schreibt ein Teil der hiesigen Startup-Szene Benefits einen hohen Stellenwert zu, um Fluktuationen zu vermeiden bzw. neue Fachkräfte anzulocken. Siehe unteren Redaktionstipp. Auch scheint einigen klar zu sein, dass sich ein Unternehmen heutzutage als “begehrenswert” präsentieren muss, möchte es “gute Leute” anwerben.
Mansbarts Ansicht nach sollte ein Mitarbeiter jedoch eine Firma nur: “joinen, weil er richtig Bock auf die Company und seine Aufgabe hat. Das soll das Mindset und die Zielsetzung sein. Nicht aufgrund allen anderes. Wähle deinen Lebenspartner, weil du IHN willst, nicht seine Garderobe, sein Erbe, seine Familie, oder sonst etwas”, sagt er. “Frauenquote und Frauenparkplätze schafft Männer-Benachteiligung, ich sehe hier einen primären Wettbewerbsnachteil fürs Unternehmen, dessen primäres Interesse immer sein sollte, den BESTEN Bewerber zu nehmen. Egal welche Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Farbe, etc. Alles andere ist Diskriminierung.”
Das Problem der Sichtbarkeit bei Frauen
Besonders der letzte Punkt, den Mansbart da zur Disposition stellte, zeigt sich problematisch und blieb natürlich nicht ohne Reaktion. Während manche davon berichteten, viel Wahres in seinen Zeilen zu sehen, betonten andere, dass der Chatarmin-Founder sie bei der Kritik an “Menstruationstagen” und “Frauenquoten” verloren hätte. Ein anderer User meinte, dass es speziell für junge Mädchen extrem wichtig sei, Frauen in Berufen durch das Gendern sichtbar zu machen.
An dieser Stelle sei eine Aussage von Storebox-Gründer Johannes Braith aus dem März 2021 in Erinnerung gerufen, in er der die Problematik zu diesem Thema bei seinem Unternehmen beschrieb. Und aufzeigt, warum Frauenförderung auch heutzutage noch essentiell ist.
Braith sagte damals offen: “Die ersten Mitarbeiter waren zwei Entwickler und ein Seller – alle männlich. Und so ging das weiter. Es war nicht so, dass wir Frauen kategorisch ablehnten, im Gegenteil. Wir beklagten uns sogar, dass wir keine Bewerberinnen hatten. Wir schoben das natürlich auf oberflächliche und auch kurzsichtige Ausreden wie ‘im Tech-Bereich gibt es einfach wenig Frauen, Logistik ist eine Männerdomäne, etc’. Dass wir selbst schuld an dieser Situation waren, begriffen wir erst viel später. Dass z.B. unsere Stellenausschreibungen absolut unpassend formuliert waren, kam uns nicht in den Sinn.”
Auch eine Studie der WU aus dem Vorjahr skizziert die eigentliche Problematik von Frauen in Tech. Darin liest man, dass die Gründe für die geringe Anzahl an Frauen in Tech-Startups nicht mangelnde Kompetenzen seien (wie Ausbildung oder Erfahrungen), sondern an der klassischen Assoziation der Tech-Szene zu finden sind, die sich in der Gesellschaft durchsetzt. “Die Tech-Szene ist bis heute vorwiegend jung, technikaffin, weiß und männlich und wird auch als solche wahrgenommen”, hieß es dort.
Was bedeutet Unternehmertum?
Abseits der 4-Tage-Woche, Grundeinkommen und frauenspezifische Themen kritisiert Mansbart auch die Einstellung von Mitarbeiter:innen der Startup-Szene. Es wirkt wie der Vorwurf der Verweichlichung von Gründern und Gründerinnen bzw. von Mitarbeitenden.
“Wenn ich im Nightjet von Köln nach Wien fahre, bin ich zehn Stunden unterwegs. Das ist ein Arbeitstag. In dem Fall halt von 22:00-08:00. Ist aber auch völlig egal. Schlafen kann ich in dem Ding eh nicht. Soll ich mir jetzt für Psycho-Hygiene Netflix Serien reinziehen? Oder mit Stirnlampe Richard David Precht lesen? Da baller ich lieber einen Blogpost, acht LinkedIn Posts, mach 20 To-Dos weg und schlaf dann halt zwei Stunden. Das akkumuliert sich longterm massiv. Die Extra-Meile zu gehen. Und macht richtig Spaß. Arbeit ist gut. Arbeit schafft Arbeit. Arbeit schafft Wohlstand. Ran an die Arbeit“, scheibt er auf Linkedin.
Spannend hierzu war eine Reaktion eines Users darauf, der den ganzen Post wie folgt zusammengefasst hat: “Was du skizzierst ist der Spirit, den man als erfolgreicher Unternehmer braucht. ABER JEDER sollte gut auf seinen Körper hören und ihm auch entsprechend Pausen, Regeneration und Inspiration gönnen, um leistungsfähig zu bleiben.”
Auf Nachfrage zu diesem Punkt erzählt der Posting-Urheber dem brutkasten, dass Unternehmertum bzw. die Selbständigkeit der schwierigste und härteste Karriere-Weg sei, den man wählen kann.
“Es ist auch der extremste, in dem 99 Prozent scheitern und ein Prozent reich entlohnt werden. Diese ein Prozent gilt es so stark wie möglich zu erzwingen. Wenn man dieser Auffassung ist, hat man auch seine Work-Ethik und seine Arbeitsmoral und -einstellung dementsprechend zu idealisieren und optimieren. Klar gehört da Anspannung und Entspannung dazu. Jeder ist unterschiedlich stark belastet. Aber die Wertschöpfung des Unternehmens entsteht primär immer während der Anspannung, sprich, der Arbeitsphasen. Entspannung oder Entlastung dient lediglich der Optimierung der Anspannung.”
Seiner Meinung nach braucht Unternehmertum schlussendlich immer zwei Dinge: “Ein Produkt und zahlende Kunden. Die meisten Startups haben weder/noch. Es wird immer nur über den Lärm rundherum geredet.”
Change und Innovation doch kein Selbstläufer
Insgesamt merkt man, dass sich Mansbart über die entstandene Diskussion freut, wie er erzählt. Und auch Kritik an seinen polemischen Aussagen eine Berechtigung hat, auch wenn User betonen, seine Worte seien polarisierend, trennend und würden der Diskussionskultur schaden. “Was hat die 4-Tage-Woche, Menstruationstage, Frauenquoten, Yoga+Physio als Corporate Benefit mit Unterdigitalisierung und Wettbewerbsunfähigkeit zu tun?“, ist eine Frage auf LinkedIn, die dort bisher unbeantwortet blieb.
Eines zumindest, möchte man etwas Positives in Mansbarts Worten finden, scheint der Post geschafft zu haben: Er hat die manchmal vor sich hindösende und uniform kritiklose Startup-Szene aufgerüttelt und wenn auch nicht alle zum Reden, so zumindest zum Nachdenken gebracht. Und gezeigt, dass auch in der Startup-Szene “Change”, oder das geliebte Wort “Innovation” auch in einer sich wandelnden Arbeitswelt, keine Selbstverständlichkeit ist; (Frauen-) und neue Rechte erst gegen Widerstand erkämpft werden müssen.
Mansbart dazu: “Ich genieße den Diskurs und Austausch. Es existiert in unserer Gesellschaft, wo jeder am Smartphone hängt und anderen zunickt, eh viel zu wenig davon. Es gehört wieder mehr am Stammtisch debattiert, Meinungen gehören respektiert und mit Rückgrat ausgesprochen. Und auch bekräftigt.”