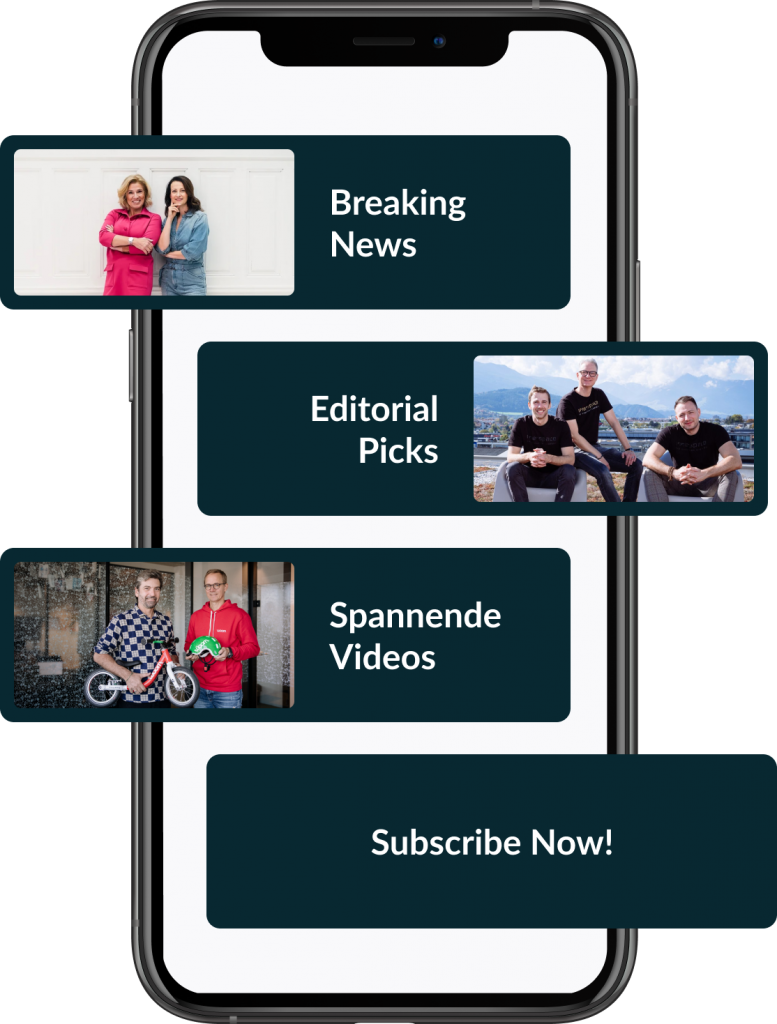✨ AI Kontextualisierung
“Corporate Venturing” is powered by AVL, Elevator Ventures, Flughafen Wien – Vienna Airport, ÖBB, Plug and Play Tech Center, Raiffeisen Bank International AG, UNIQA Ventures und VERBUND AG.
Mit der brutkasten-Serie Corporate Venturing widmen wir uns Innovationsaktivitäten von Großunternehmen wie der Zusammenarbeit mit Startups und Scaleups oder dem Venture Building. Wir arbeiten dabei heraus, wie unterschiedlichste Aktivitäten in diesem Feld als Innovationsmotor für die österreichische Volkswirtschaft fungieren können.
In dieser Folge sprechen Corporate-Vertreter über Kollaborationsmodelle mit Startups und Community Building. Sie beschreiben die Anforderungen für erfolgreiche Accelerator-Programme, erklären, wie Unternehmen von der Zusammenarbeit profitieren und ziehen Bilanz über ihre Pionierrolle im Corporate Venturing in Österreich.
Zu Gast bei brutkasten-Gründer und -CEO Dejan Jovicevic waren in dieser Folge Franz Zöchbauer, Managing Director bei Verbund Ventures, Andreas Nemeth, CEO von Uniqa Ventures, und Peter Schindlecker, Head of Innovation bei den ÖBB.
- Kollaborationsmodelle und ihre Bedeutung
- Erfolgsfaktoren von Accelerator-Programmen
- Vorteile und Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Startups
- Erfolgsbeispiele und Ergebnisse
- Community Management und Zukunftsperspektiven
1. Kollaborationsmodelle und ihre Bedeutung
Andreas Nemeth, heute CEO von Uniqa Ventures, erinnert sich zu Beginn des Talks an seine Anfänge bei Uniqa. Er sei damals ausgewählt worden, da er bereits bei drei Startups gearbeitet hatte, Uniqa Ventures war sozusagen das vierte Startup in seiner Karriere. Die Wahl sei wohl deswegen auch auf ihn gefallen: “Ich spreche die Sprache des Corporates und der Startups und wollte die Brücke zwischen den beiden bauen.” Mit dem Accelerator-Programm Health Hub habe man Schritt für Schritt begonnen, Startups und die Uniqa zusammenzubringen.
Für dieses Herantasten sind für Nemeth Kollaborationsmodelle wie ein Accelerator-Programm ein guter Start. Uniqa sei ein 200 Jahre altes Unternehmen mit 20.000 Mitarbeiter:innen, wenige davon hätten je in einem Startup gearbeitet. Gründer:innen hingegen hätten oft die besten Ideen um zwei Uhr nachts, außerhalb herkömmlicher Bürozeiten. “Das ist für beide Seiten durchaus ein Abenteuer”, sagt Nemeth. Da brauche es einen gemeinsamen Partner, der diesen Prozess moderiert.
Für Franz Zöchbauer, Managing Director bei Verbund Ventures, war die Etablierung des Verbund Accelerator ein “ganz wichtiger Schritt für die Entwicklung zur Innovation bei Verbund und in der Zusammenarbeit mit Startups”. Begonnen habe man bei Verbund mit einem neuen Innovationssetup und einer internen Initiative 2019, der Accelerator startete 2020. Das Unternehmen müsse bereit sein, mit Startups zu interagieren und zu kooperieren. Vor zwei Jahren sei in Folge des Verbund Accelerators dann Verbund Ventures gegründet worden.
Bei der Uniqa war dieser Prozess für Andreas Nemeth ein “gleitender Übergang”. Die Idee, Corporate Venturing zu betreiben sei aus der Idee heraus entstanden, das “Wesen Startup” zu verstehen und von Startups zu lernen. “Wir haben vermutet, dass Startups an innovativen Trends früher dran sind und wollten uns das zu nutzen machen”, erklärt Nemeth. Uniqa wollte Startups hereinholen, die bei manchen Themen bereits weiter waren und so Innovation im eigenen Unternehmen beschleunigen.
Im Gegensatz zu produzierenden Unternehmen gebe es bei Uniqa keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Innovation werde in das Kerngeschäft eingebettet. Die eigenen 20.000 Leute seien das Kreativpotential, das durch die Zusammenarbeit mit Startups erweitert werden sollte. Nemeth fasst es so zusammen: “Was ein Startup auszeichnet, ist kreativ, schnell, innovativ zu sein. Was ein Corporate auszeichnet, ist beständig zu sein und über die ausreichenden Ressourcen zu verfügen, Dinge auch einmal auszuprobieren und vielen Menschen zugänglich zu machen.” Die Kombination dieser beiden Stärken sei am Beginn des Innovationsprogramms gestanden.
Bei den ÖBB gab es bereits vor dem bewussten Start eines Innovationsprogramms eine Open-Innovation-Strategie, wie Peter Schindlecker, Head of Open Innovation, erklärt. Das Programm an sich sei dann eine Verknüpfung eines Entrepreneurship-Programms mit Startup-Interaktionen geworden. Man habe bewusst kein Single-Corporate-Programm aufgebaut, da man festgestellt habe, dass hier oft Zeit auf der Strecke bleiben würde. Man sei daher von einem Use Case ausgegangen, habe den ausgebaut und sei danach ergebnisoffen. Das habe gut funktioniert, nun müsse man aber am eigenen Venture Clienting arbeiten und ein besserer Kunde werden. Für diese Transformation brauche man Unterstützung, das werde man vor einem Accelerator-Aufbau angehen.
2. Erfolgsfaktoren von Accelerator-Programmen
Was macht nun den Erfolg von Accelerator-Programmen aus? Franz Zöchbauer erzählt, dass ihm zum Start des Verbund X Accelerators vor allem wichtig gewesen sei, kein Startup-Programm von Verbund zu machen, sondern Startups eine Plattform zu bieten. Von Anfang an sollte es ein Multi-Corporate-Accelerator werden. Im Gespräch mit den Business-Units habe man herausgearbeitet, wer interessante Corporate-Kunden sind, die gemeinsam mit Verbund Innovation betreiben wollen.
Diese breite Aufstellung habe es dann auch für Startups interessanter gemacht, sich zu bewerben. Generell wichtig ist für Zöchbauer ein klar strukturiertes Programm. Das Startup muss wissen, wie viel Zeit investiert werden muss, wie der Ablauf weitergeht, sollten sie ausgewählt werden, oder wie das Budget aufgestellt ist. Geht man hier als Startup eine längerfristige Partnerschaft ein oder ist das Programm nach drei, vier Monaten abgeschlossen?
Die Erwartungshaltungen beider Seiten müssen für Zöchbauer klar kommuniziert werden. Auch als Organisation müsse man sich vorbereiten. Im besten Fall liege am letzten Abend des Innovation Camps ein fertiger Vertrag vor, den das Startup nur noch unterschreiben müsse. “Diese Fast Lane sicherzustellen war unsere Aufgabe als Innovationsabteilung, das ist unser Wertversprechen gegenüber dem Startup”, sagt Zöchbauer. Angesprochen auf das Budget meint Zöchbauer, bei Verbund zahle man für den Proof of Concept bzw. den Piloten. Dieses Budget könne innerhalb weniger Tage freigegeben werden. Über eine Finanzierung werde eine Kooperation insgesamt ernsthafter.
Für Andreas Nemeth gibt es zwei Modelle: Corporates, die ein eigenes Programm wie ein Innovation Championship starten und gezielt nach Startups suchen, die sich passenden Themen widmen. Oder der Open-Innovation-Ansatz, für den sich Uniqa entschieden hat. “Wir wollen Innovation ja nicht nur bei uns machen, wir wollen uns öffnen”, fasst Nemeth es zusammen. Durch die Suche in einem Multi-Corporate-Accelerator sei man viel attraktiver und sehe außerdem viel mehr Startups.
Manche bewerben sich vielleicht für ein anderes Corporate, passen dann aber besser zu einem selbst. Das Wichtigste ist für Nemeth die klare Definition der Suchfelder und interessanter Themen. Innerhalb der Organisation sollten auch bereits früh zuständige Personen identifiziert und mit einem Budget ausgestattet werden, die dann der Corporate Buddy des Startups sind. Und die schnell realisierbare Aufgabenstellungen definieren können.
Genau wie Zöchbauer spricht Nemeth über die Bedeutung eines klaren Erwartungsmanagements: Was soll das Startup beitragen? Wozu verpflichtet sich das Corporate? Was sind die verfügbaren Ressourcen? “Eines der Erfolgskriterien ist aus unserer Sicht, schnell – innerhalb eines Accelerator-Programms spricht man meist von drei bis sechs Monaten – gemeinsam auf die Bühne zu treten und gemeinsam zu präsentieren, was erreicht wurde”, sagt Nemeth. Das müssten kleine, schnelle Projekte sein. Es sei besser, in drei Monaten einen kleinen Erfolg zu erzielen als auf das bahnbrechende Projekt zu warten.
Für Peter Schindlecker ist ein wichtiges Erfolgskriterium die Abnahme eines Projekts. Bleibe ein Projekt weiter in der eigenen Abteilung hängen und werde durch das eigene Budget finanziert, sei das nur eine Übergangslösung. Denn der Mehrwert entstehe erst im Kundenzugang. Auch bei Verbund sei das eine offizielle KPI, sagt Franz Zöchbauer: Je mehr Projekte oder Themen man abgebe, desto erfolgreicher sei man. Wandert ein Thema von der Innovation auf die Business-Seite, bringt es Geschäft.
An dieser Stelle wirft Schindlecker ein, was sich Unternehmen stets fragen sollten: “Was können wir anbieten, worin sind wir gut?” Gerade bei den ÖBB habe man die Situation, dass im Bahnwesen Projekte oft in einer sehr geschützten Testumgebung entstehen würden. Da sei es oft nicht so leicht, seine Erfolge und seine Kompetenz zu zeigen. Als Corporate könne man aber Expert:innenzugänge bieten. Ob eine Lösung erfolgreich sei, könne man dann daran messen, dass sie auch außerhalb dieses abgeschirmten Bereichs funktioniere.
3. Vorteile und Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Startups
Um auch ein Startup zu Wort kommen zu lassen, wird während des brutkasten-Talks ein Statement von Marcus Weixelberger eingeblendet. Er ist CEO und Founder von andys.cc, die Office-as-a-Service-Lösungen anbieten, und arbeitet mit den ÖBB zusammen. Zu Beginn habe man Corporate Venturing nicht im Fokus gehabt, sondern Kapital als klassisches Work for Equity aufgestellt. Man wollte mit Unternehmen zusammenarbeiten, die einen verstehen und als Sparring-Partner dienen. In ihrem Fall habe das geholfen, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und kritisch zu hinterfragen.
“Wenn man tagtäglich in seinem eigenen Saft kocht, braucht man Menschen, die Fragen stellen, die vielleicht kritisch sind und wehtun, aber einem dabei helfen, über gewisse Situationen und Entwicklungen nochmal nachzudenken”, sagt Weixelberger. Peter Schindlecker von den ÖBB erzählt, dass diese Kooperation im ÖBB Immobiliengeschäft entstanden sei, weil die dortigen Kolleg:innen dafür gekämpft hätten. Schindlecker freut es, dass hier gegenseitiges Vertrauen entstanden sei und auch das Startup den Kundenkontakt schätzt.
Aber hat man als Corporate und Startup innerhalb eines Accelerators genug Zeit, dieses Vertrauen aufzubauen und gemeinsam ins Tun zu kommen? Für Franz Zöchbauer ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung, da Vertrauen über eine Vielzahl von Kontakten entstehe. Beim Verbund Accelerator arbeite man zum Beispiel in der ersten Phase drei Tage zusammen und befindet sich danach drei bis vier Monate in der Acceleration Phase. Hier gebe es viele Anknüpfungspunkte.
Längerfristiges Vertrauen entstehe dann über Jahre innerhalb der entstandenen Partnerschaft. Denn gerade große Unternehmen fragen sich, wie stabil ein Startup ist und ob es in zwei bis drei Jahren noch aktiv ist. Man habe beim Verbund einige Beispiele für jahrelange Zusammenarbeit, aus der richtiges Vertrauen und intensiver Austausch entstanden sei. Zöchbauer nennt eFriends oder eologix-ping als Beispiele, in die Verbund investiert hat. Mit dem Schweizer Startup SmartHelio habe man eine erfolgreiche Kooperation. Nach einem ersten Piloten habe man nun ein gemeinsames Projekt bei einer PV-Anlage von Verbund in Spanien.
Das Sichten so vieler Startups kann für Corporates auch als externe Innovationsunit dienen, wie brutkasten-CEO Dejan Jovicevic anmerkt. Für Andreas Nemeth ist ein Accelerator ein guter Anfang in diese Richtung, das sei auch bei Uniqa der erste Schritt gewesen: “Das ist ein Speed-Dating-Programm.” Man versuche, die Mitarbeiter:innen eines Unternehmens möglichst schnell mit einem Startup zu vernetzen und umgekehrt die Business-Development-Verantwortlichen des Startups mit möglichst vielen Entscheidungsträger:innen im Unternehmen zu vernetzen.
Hat man in dieser Phase bereits erste Erfolge, mache das Appetit auf mehr. Wichtig sei auch der Übergang am Ende des Accelerators. Hier sollte man sich zusammensetzen und fragen, wie man in weiterer Folge zusammenarbeiten könne. Könnte man als Corporate ein Investment tätigen? Bei Uniqa habe man durchaus in Startups aus dem Accelerator später investiert, zum Beispiel doctorly oder Tele Media. Gerade Startups würden von diesem direkten Zugang in ein Corporate profitieren.
Nemeth betont an dieser Stelle erneut die Rolle des Erwartungsmanagements: “Nach dem Accelerator kommt in den wenigsten Fällen der Millionenauftrag.” Daher sei der Übergang und die Pflege der Beziehungen zueinander so wichtig. In manchen Fällen zahle sich der lange Atem aus: Omnius war im Accelerator von Uniqa dabei, in Summe habe es über zwei Jahre gedauert bist die Lösung des Startups auch in Produktion gegangen sei.
Für Peter Schindlecker ist ein Proof of Concept eine gute Basis, da man damit beweisen könne, ob eine Idee überhaupt möglich sei. Ein “Das kriegt ihr ja nie hin!” könne man damit wegwischen. Danach brauche es aber die Verankerung und ein gemeinsames Team, das die Lösung dann baue. Bei den ÖBB positioniere man sich nicht allein als Investor, sondern brauche immer auch diesen Business Background.
Das Open-Innovation-Team bei Uniqa habe es Andreas Nemeth zufolge geschafft, diese fortlaufende Interaktion zwischen Corporate und Startup zu unterstützen und zum Beispiel Standardverträge zu konzipieren. Damit komme man schneller in die Umsetzungsphase. Das sei aus der Überlegung heraus entstanden, einen Papierkrieg zwischen Startup und Corporate zu vermeiden, wenn beide doch an der Zusammenarbeit interessiert sind. “Unsere Prozesse in einem großen Unternehmen sind oft darauf ausgerichtet, mit anderen großen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber ich muss auch eine Andockstelle schaffen, wie ein 20.000 Mann-und-Frau-Unternehmen mit einem Startup mit zwölf Mitarbeitern interagieren kann”, sagt Nemeth.
Wie erzeugt man nun eine Win-Win-Situation für beide Partner auf Augenhöhe? Für Franz Zöchbauer braucht es hier zuerst einmal Transparenz, was die eigenen Zielvorstellungen als Corporate angeht. Hier dürfe es keine Hidden Agenda geben. Zweitens müsse man die Freiräume und die Formate schaffen, um gemeinsam Win-Win-Situationen zu schaffen.
Für Peter Schindlecker sind schlanke Verträge ein Muss. Hat man das als Corporate nicht vorbereitet, wird das von einem Startup als nicht respektvoll wahrgenommen. Hier stehe auch ein anderes Grundverständnis als bei klassischen Startup-Pitches dahinter: Man müsse als Corporate zuerst Unternehmen finden, zu deren Wachstumsidee man auch passe. Im europäischen Speditions- und Logistikbereich gebe es mittlerweile so starke Teams, da müsse man sich auch als ÖBB bemühen. Diese Einstellung als Unternehmen sei vor fünf Jahren noch sehr anders gewesen.
Andreas Nemeth und Franz Zöchbauer nennen das “Angleichen der Geschwindigkeiten” als Faktor. Was heißt das? Nemeth erklärt, dass “so schnell wie möglich” in einem Startup vielleicht “über Nacht” heißen kann – in einem großen Unternehmen kann das aber auch “einige Woche oder Monate” heißen. Dieses Übersetzen und Angleichen der unterschiedlichen Erwartungen sei wichtig. Für Franz Zöchbauer sind diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch ein Grund, warum der Verbund Accelerator zwei Mal im Jahr angeboten wird. Damit sei es leichter, einen Zeitpunkt zu finden, zu dem die Business Units auch Zeit für die Startups haben.
“Ein schnelles Nein ist eher hilfreich als zu lange unklar nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen”, fügt Andreas Nemeth hinzu. Auch Absagen sollten klar kommuniziert werden, das zeuge vom Reifegrad eines Unternehmens. Startups seien außerdem eine fragile Organisation, die man durch monatelanges Warten auf eine Entscheidung auch “umbringen” könne. Hier müsse man auch innerhalb des Corporates Verständnis für die andere Seite schaffen und seine Sprache auch dementsprechend anpassen. “Drei oder sechs Monate können bei einem Startup über Sein und Nicht-Sein entscheiden”, sagt auch Franz Zöchbauer. In einem großen Unternehmen mache das vielleicht keinen großen Unterschied, aber für Startups kann diese Zeit bedeutend sein.
4. Erfolgsbeispiele und Ergebnisse
Zu Beginn habe man mit Blick auf die Acceleratoren-Programme quantitative KPIs gemessen, sagt Franz Zöchbauer von Verbund Ventures: Wie viele Pilotprojekte schafft man? Wie viele Proof of Concepts? Mittlerweile sei man dazu übergegangen zu messen, ob sich langfristige Partnerschaften entwickelt haben. Wurde eine Technologie wirklich in der Business Unit eingesetzt?
Dann könnte man im nächsten Schritt auch messen, ob dadurch Kostenersparnisse erreicht wurden oder neues Umsatzpotential erreicht wurde. War man mit Produkten geschwinder am Markt? Das seien viel interessantere KPIs, da sie den Inhalt abbilden würden, meint Zöchbauer. Ob es durch die Zusammenarbeit von Corporate und Startup auch Wettbewerbsvorteile entstanden sind, könne man vor allem durch Zeit messen: Wie lange hätten eine Business Unit oder Verbund gebraucht, um ein neues Produkt einzuführen und um wie viel konnte man das über eine Kooperation mit einem Startup beschleunigen?
Auch Andreas Nemeth erzählt, dass Uniqa anfangs vor allem Neues lernen wollte und sich verschiedene Startups ansehen wollte. Über die Jahre ist Uniqa so mit über 2.000 Unternehmen in Kontakt gekommen, in 58 davon habe man investiert – und 14 Exits geschafft. Mit 60 bis 70 Unternehmen habe man Partnerschaften diskutiert und umgesetzt. Hier sei in neun Jahren viel mehr entstanden, als man erwartet hätte. Zu Beginn wäre die strategische Überlegung im Vordergrund gestanden, sich Zugang zu neuen Ideen zu verschaffen und zukünftige Wachstumsfelder zu erschließen.
Mittlerweile mache man das “ganz klar aus finanziellen Motiven”, der Return der Investments liege mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich. Uniqa-CEO Andreas Brandstetter würde nicht nur die Internal Rate of Return beachten, sondern auch die schwieriger messbare Innovation Rate of Return. Die sogenannte digitale Dividende – zusätzlich zur finanziellen Dividende – messe die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Die Vision hinter der Innovationsstrategie bei Uniqa sei es, nicht nur für die jetzigen zwölf Millionen Kund:innen relevant zu sein, sondern das auch in Zukunft zu bleiben. Durch die Zusammenarbeit mit Startups habe man sich auch selbst verändert, mit der Mavie-Gruppe habe man zum Beispiel das Geschäftsfeld der digitalen Gesundheit neu eröffnet.
Für Nemeth ist die Uniqa so zu einem zukunftsfitten Unternehmen geworden, dass heute auch als Arbeitgeber spannender und attraktiver sei. Corporate Venturing kann also auch im Employer Branding zu Verbesserungen führen, selbst wenn das anfangs nicht als KPI festgelegt wurde. Nemeth erzählt, dass Uniqa Ventures zum Beispiel für eine ausgeschriebene Stelle 321 Bewerbungen erhalten habe. Die Zusammenarbeit mit Startups sei für viele Bewerber:innen attraktiv. Auch Franz Zöchbauer erzählt, dass er für zwei ausgeschriebene Stellen raschere und sehr hochqualitative Bewerbungen erhalten habe. “Das ist ein extrem gutes Signal.” Für Zöchbauer wird hier sichtbar, dass die Startup-Kollaborationen auch nach außen in die Peer Group hinein wirken. “Das ist wichtig für neue Talente, die wir in Zukunft brauchen”, resümiert er.
Bei den ÖBB habe man ebenfalls nicht aus dem Employer Branding heraus Corporate Venturing angefangen, meint Peter Schindlecker. Heute sehe man diesen Einfluss aber sehr wohl. Das Team ziehe neue Leute an, die ebenfalls bei den ÖBB arbeiten wollen. Für Schindlecker ist auch Community Building eines der wichtigsten Themen. Gerade in der Mobilität würde man viele Player:innen zusammenholen wollen – nicht nur Startups, auch Vereine oder ähnliche Organisationen. Neben der Community sind für Schindlecker vor allem die gelaunchten Produkte ein Erfolgsfaktor. Die meisten Launches seien durch Kooperationen mit Startups entstanden, der Vorstand liebe diese neuen Features heiß.
5. Community Management und Zukunftsperspektiven
Für Peter Schindlecker ist Community Building essentiell: “Du musst es machen, sonst bekommst du die Leute nicht. Sonst bist du unglaubwürdig und uninteressant.” Niemand würde heute nur für Geld mitarbeiten, man brauche einen Impact und eine Mission dahinter. Herausforderungen wie die Klimakrise, die Mobilitätskrise – das ziehe Leute an. Franz Zöchbauer stimmt dem zu, vor allem die Bereiche Nachhaltigkeit, Health und KI würden “irrsinnig viele” Talente anziehen, die an diesen großen, schwierig zu lösenden Problemen arbeiten wollen.
Bei Verbund würde die Mission Klimaschutz und nachhaltige Energie Menschen anziehen, die hier einen konkreten Beitrag leisten wollen. Community Management betreibe man nicht aus Nächstenliebe, sondern weil es einen Return für die eigenen Aktivitäten gebe. Als Corporate könne einem nichts besseres passieren, als von Startups weiterempfohlen zu werden oder als guter Investor bezeichnet zu werden. Bei Verbund beginne man im Moment damit, auch den Net Promoter Score zu messen und sich anzusehen, ob man weiterempfohlen werde. Eine Empfehlung von einer Business Unit oder Ansprechpartner:innnen – “das ist für uns die beste Benchmark”, sagt Zöchbauer.
Auf die Frage nach der Zukunft der Corporate-Venturing-Aktivitäten sagt Zöchbauer nur: “Das einzig Konstante ist der Wandel.” Man müsse sich ständig weiterentwickeln und laufend anpassen. Für Andreas Nemeth sind Acceleratoren und Corporate Venturing die Zukunft, deswegen sei es wichtig und mache Spaß. Und: “Spaß macht es ja deswegen, weil es erfolgreich ist und erfolgreich ist es, weil es die Antwort auf die Organisationsform der Zukunft ist.”
Unternehmen könnten heute nicht mehr alleine am Markt stehen und hinter den eigenen Mauern ihre Produkte entwickeln. Wertschöpfung sei heute vernetzt und passiere in Netzwerken über die Unternehmensgrenzen hinaus. Teilweise müsse man in Partnerschaft mit Konkurrenten arbeiten. Aus diesem Grund seien Acceleratoren und Multi-Corporate-Programme die richtige Antwort: “Niemand kann die Probleme der Zeit heute alleine bewältigen, sondern nur noch gemeinsam.”
Genau deswegen sei ein Ökosystem, wie es sich heute in Österreich etabliert hat, so wichtig. Früher habe man für Beispiele nach Deutschland oder in die USA blicken müssen, heute gebe es in Österreich genug Unternehmen, die dem Beispiel von Uniqa gefolgt seien und mit ihrem Corporate Venturing mittlerweile auf breiten Beinen stehen würden. Auch als Uniqa habe man viel von anderen Unternehmen gelernt: “Wir waren wahnsinnig dankbar, dass wir uns austauschen konnten und es eine offene Kultur zwischen den Innovationsabteilungen oder auch Corporate-Venturing-Abteilungen gibt.”
Nicht die Konkurrenz, sondern der gemeinsame Erfolg stehe im Vordergrund. Nemeth lädt auch andere Unternehmen ein, an die Uniqa heranzutreten, um Fragen zu stellen. Genau wir die anderen Unternehmen dieser brutkasten-Serie sei man gerne Testimonial für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Corporates und Startups. Warum? “Das wird die Zukunft sein. In Zukunft wird es keine andere Form der Zusammenarbeit geben.”
Du willst mehr wissen? Schau dir die ganze Folge an!
Die Serie wird von brutkasten in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung unserer Partner:innen produziert.