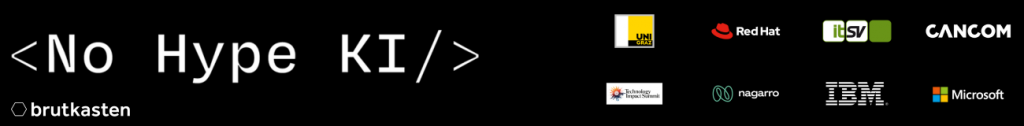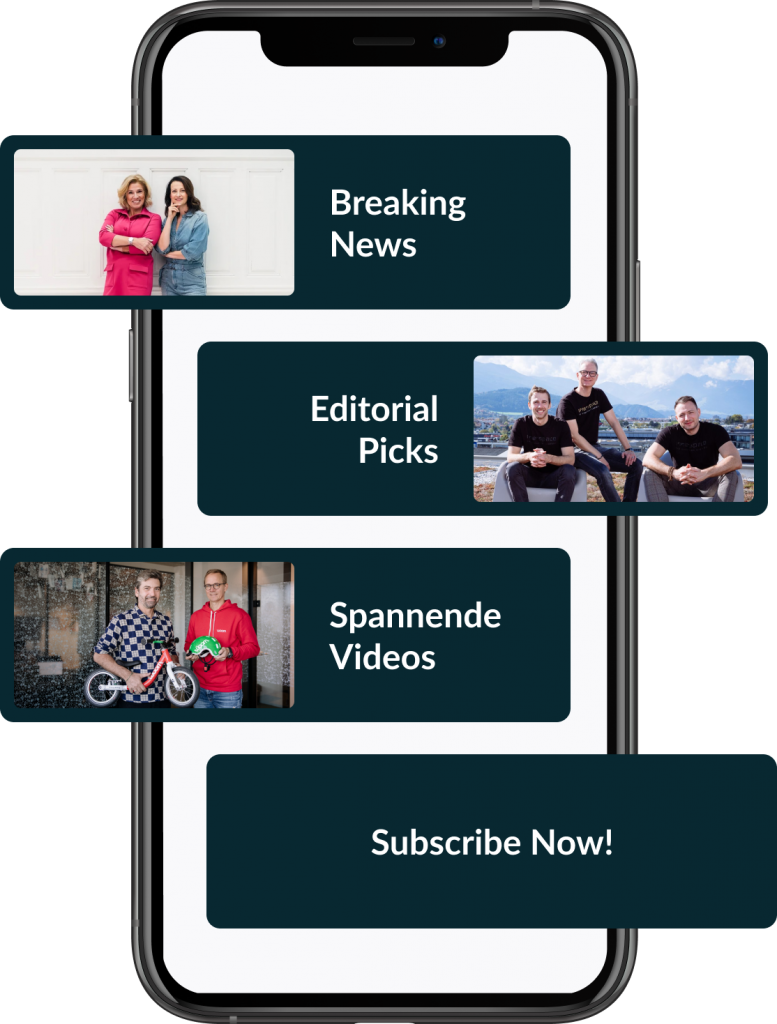✨ AI Kontextualisierung
“Corporate Venturing” is powered by AVL, Elevator Ventures, Flughafen Wien – Vienna Airport, ÖBB, Plug and Play Tech Center, Raiffeisen Bank International AG, UNIQA Ventures und VERBUND AG.
Mit der brutkasten-Serie Corporate Venturing widmen wir uns Innovationsaktivitäten von Großunternehmen wie der Zusammenarbeit mit Startups und Scaleups oder dem Venture Building. Wir arbeiten dabei heraus, wie unterschiedlichste Aktivitäten in diesem Feld als Innovationsmotor für die österreichische Volkswirtschaft fungieren können.
In der ersten Folge haben wir beleuchtet, wie man als Unternehmen überhaupt mit Corporate Venturing starten kann und welche Strukturen es dafür braucht. In der zweiten Folge gingen wir der Frage nach, wie man den Impact der eigenen Corporate-Venturing-Aktivitäten messen kann. In der dritten Folge beleuchteten wir das Thema Corporate Venture Capital (CVC) und dessen Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen Großunternehmen und Startups.
In der vierten Folge kamen nun Vertreter:innen von Startups, die im Rahmen von Corporate Venturing-Aktivitäten mit Großunternehmen zusammenarbeiten, selbst zu Wort. Was braucht es aus ihrer Sicht für eine gelungene Partnerschaft, welche Voraussetzungen bestehen und welche Hürden können auftreten? Ob die Zusammenarbeit gelingt und das vielbeschworene „Beste aus beiden Welten“ zu erfolgreichen Ergebnissen führt, ist nämlich von mehreren Faktoren abhängig.
Zu Gast bei brutkasten-Gründer und -CEO Dejan Jovicevic waren dazu Antonella Cvrtak, Customer Growth Lead bei nista.io, Martin Micko, Founder & COO bei omnius, Klara Dimmel, Co-Founderin eFriends Energy und Eric Weisz, Co-Founder Circly.
1. | Was haben Startups von der Zusammenarbeit mit Corporates?
2. | Die richtigen Voraussetzungen und Strukturen
3. | Hürden und der Clash of Cultures
4. | Die Rolle von Corporate Venture Capital (CVC)
1. | Was haben Startups von der Zusammenarbeit mit Corporates?
Corporate-Venturing-Aktivitäten gehen – wie die Bezeichnung nahelegt – von Corporates aus. Damit einher sollte – wie in den vorangegangenen Folgen der Serie herausgearbeitet – eine klare Zielsetzung gehen. Und mit dieser eine konkrete Vorstellung davon, was das Großunternehmen von der konkreten Aktivität, etwa der Zusammenarbeit mit Startups und Scaleups, hat.
Auf der anderen Seite, jener von Startups und Scaleups, ist die Sache also gar nicht so leicht. Denn ob man mit der Erreichung der Ziele des Corporates auch eigene Ziele erreichen kann und die erwünschte Win-Win-Situation auftritt, ist nicht gesagt. Letztlich kann die Zusammenarbeit aber nur dann gelingen, wenn beide Seiten profitieren.
„Als Startup ist es das Non plus Ultra, ein großes Unternehmen zu deinen Kunden zu zählen“
Eine Zielsetzung auf Seiten der Startups liegt auf der Hand: Das Großunternehmen als zahlenden Kunden zu gewinnen. Und das nicht nur, weil es direkt Umsatz bringt. „Als Startup ist es das Non plus Ultra, ein großes Unternehmen zu deinen Kunden zu zählen. Das hat eine Strahlkraft, die dich bei jedem Corporate positioniert, bei dem du an die Tür klopfst“, meint omnius-Gründer Martin Micko.
Micko bringt selbst jahrelange Erfahrung als C-Level-Manager im Corporate mit. Sein InsurTech-Startup mit Hauptsitz in Berlin fährt mit seiner KI-basierte Software für Schadenautomatisierung für Versicherungen eine klare B2B-Strategie. Eines der Corporates, mit denen omnius zusammenarbeitet, ist der Versicherer UNIQA, der mit seinem CVC-Arm UNIQA Ventures auch in das Startup investiert ist.
Partnerschaft statt Disruption
Als Herausforderer – im Startup-Jargon „Disruptor“ – der Großunternehmen aufzutreten, kommt für Micko nicht infrage. „Es gibt Startups, die auf Disruption setzen. Wir haben im InsurTech-Kontext nie daran geglaubt, weil die Versicherungsbranche hochgradig reguliert ist. Das ist aus unserer Sicht auch der Grund, warum es bis heute keine Hyperscaler in der Branche gibt“, meint der omnius-Gründer. Entsprechend habe man immer das Ziel verfolgt, Partnerschaften mit großen Playern zu schließen, „und nicht mit ihnen in Konkurrenz zu treten, was für uns komplett unrealistisch wäre“.
Rahmenbedingungen auf beiden Seiten
Und wie gelingen diese Partnerschaften? In der Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups bedürfe es gewisser Rahmenbedingungen auf beiden Seiten, meint Micko. Dann könne wirklich gemeinsam an der Lösung gearbeitet werden. „Das ist für beide Seiten sehr fruchtbar, weil das Produkt maßgeblich mitgestaltet werden kann, und zwar hands-on aus dem Corporate-Environment“, sagt der Gründer. „Das ist schon eine irre Kraft, die da entstehen kann.“ Das Corporate brauche dabei die richtige strategische Ausrichtung, das Startup die Flexibilität, auf die Corporate Environments einzugehen.
Mit gemeinsamen Learnings zur Win-Win-Situation
Mit diesem Eingehen auf das Corporate Environment musste sich auch eFriends-Gründerin Klara Dimmel eingehend beschäftigen. „Die Innovationen kommen zwar vielfach von den Startups, sind aber auch in den großen Unternehmen da“, sagt sie. Die Möglichkeiten für die Umsetzung gemeinsamer Projekte seien aber oft schwer, Systeme sehr träge.
Als Positiv-Beispiel – mit vielen Learnings auf dem Weg – nennt Dimmel die Kooperation ihres Energy-Sharing-Startups mit Verbund, dessen CVC-Einheit VERBUND X Ventures auch in das Unternehmen investiert ist. Der Energieanbieter und das Startup bauten gemeinsam eine Energiegemeinschaft auf – und zogen daraus Schlüsse: „Wir haben zunächst gesehen: Es ist ein träges System. Es ist für den B2B-Bereich schwer, einen Vorteil zu finden, weil Energiegemeinschaften ja gemeinnützig sind. Wir wollen aber gemeinsam mit den Corporates ein Business machen. Wir haben mit dem Energy-Sharing dann ein Business gefunden, bei dem beide ihren Vorteil haben“, erzählt Dimmel.
Es gehe in der Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups aber nicht unbedingt darum, neue Geschäftsfelder aufzubauen. Im Sinne des Innovationspotenzials innerhalb der Corporates gehe es auch darum, „eine Möglichkeit von außen aufzubauen, dieses Potenzial auszuschöpfen“. „Da kann man sehr viel bewirken und sich gegenseitig befruchten“, meint die eFriends-Gründerin.
Partnerschaft als Voraussetzung für das Startup
Für Circly-Gründer Eric Weisz war die frühzeitige Partnerschaft mit großen Unternehmen absolute Voraussetzung, sein Business überhaupt in die Gänge zu bringen. Das Startup, das mit seinem System KI-basierte Absatzprognosen für Produzenten, Großhändler und Einzelhändler bietet, ist nämlich auf Daten von Kunden angewiesen, um die Sinnhaftigkeit des Produkts zu zeigen.
Um diese Partnerschaften zu starten, seien Vertrauen und die menschliche Komponente zentral, erläutert Weisz. „Wir sind alle Technologie-Unternehmen und doch kommt es immer wieder zurück auf den Menschen. Man braucht das Vertrauen bestimmter Unternehmen, wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist. Wenn wir zu Beginn keine Daten bekommen hätten, hätte es uns gar nicht gegeben. Wir mussten also Kunden akquirieren ohne eine Zeile an Code, weil der erst auf Basis der historischen Daten erstellt werden konnte“, erzählt der Gründer.
„Sonst können wir in unserem Kämmerchen sitzen und uns tolle Lösungen ausdenken“
So habe man etwa zunächst die Österreichische Post, dann die Kastner Gruppe als Kunden überzeugen können. Aktuell befindet sich das Startup in einem großen Kooperationsprojekt mit dem Flughafen Wien. „Das Unternehmen auf der gegenüberliegenden Seite ist also auch für uns als Startup notwendig, um Innovation zu betreiben. Sonst können wir in unserem Kämmerchen sitzen und uns tolle Lösungen ausdenken, aber wenn sie nicht vom Markt adaptiert werden, ist es nicht wirklich eine Innovation“, sagt Weisz.
2. | Die richtigen Voraussetzungen und Strukturen
Die Zusammenarbeit mit Corporates kann also nicht nur diesen, sondern auch den Startups erhebliche Vorteile bringen. Dennoch ist Vorsicht geboten: Damit die Kooperation gelingt, müssen beide Seiten ihre Hausaufgaben machen. Es braucht bestimmte Voraussetzungen, Strukturen und ein planvolles Vorgehen.
Discovery-Prozess gleich zu Beginn
Antonella Cvrtak von nista.io hat damit Erfahrungen. Am Anfang als TU-Wien-Spinoff habe man, wie auch zuvor von Weisz für Circly beschrieben, Partner aus der Industrie gewinnen müssen, um das Produkt überhaupt aufzubauen. Später, als es um Kundenbeziehungen und damit auch um den Return on Investment ging, sei aber klar geworden: „Man muss einen Fokus darauf legen, mit wem man zusammenarbeiten möchte und mit wem nicht.“
Eine „riesige Erkenntnis“ sei gewesen, gleich am Anfang in einen Discovery-Prozess zu gehen. „Man muss sich die Zeit nehmen, um herauszufinden: Wer ist der Kunde? Was sind die Erwartungen? Was sind die Bedürfnisse? Und können wir das wirklich lösen?“, erklärt Cvrtak. Dann müsse man zusammen mit den Kunden die gemeinsamen Ziele definieren. Gelungen ist das nista.io unter anderem mit AVL – das Startup und das Großunternehmen betreiben aktuell ein gemeinsames Projekt.
„Gemeinsam schnell lernen, aber auch schnell scheitern“
Eric Weisz spricht in diesem Zusammenhang von einer Lernkurve. „Am Anfang versucht man, mit jedem in eine Partnerschaft zu gehen. Im Laufe der Zeit lernt man, dass eine Disqualifikation fast besser ist, um die Gesundheit des Unternehmens zu gewährleisten.“ So achte man bei Circly stark darauf, sich nur auf die Kernindustrie, „die schnelldrehende Konsumgüterbranche“, zu konzentrieren.
„Da ist der Pain Point sehr groß. Es entsteht sofort der Respekt vor uns, der auch Basis für das notwendige Vertrauen ist. Wenn man diese Wertschätzung verspürt, macht es auch Spaß, miteinander zu arbeiten“, sagt Weisz. Dann komme es darauf an, „gemeinsam schnell zu lernen, aber auch schnell zu scheitern“. „Dazu braucht es auch eine Offenheit“, sagt der Gründer. Denn „Man muss dazu die ‚Fear of Failure‘ ablegen. Wenn man aus Angst vor dem Scheitern nie etwas probiert, dann hängt der Karren.“
Die richtigen Ansprechpartner:innen identifizieren
Martin Micko wirft ein, es gelte bestimmte Dinge mitzuberücksichtigen: „In einem Corporate trifft fast nie eine einzelne Person Entscheidungen, sondern meist eine Gruppe.“ Die Personen hätten unterschiedliche Interessen und Agenden. „Das muss man herausfinden und das ist oft schwierig zu verdauen. Manchmal ist die Unternehmens-Politik gegen dich“, sagt der Gründer. Diese habe eine wesentliche Rolle im Corporate.
„Da habe ich inzwischen eine gewisse allergische Reaktion“
Wenn man die Strukturen im Corporate verstehen wolle, müsse man sich auch ansehen, wie Innovation dort vorangetrieben werde. „Die klassischen Innovationsabteilungen sind typischerweise die ersten, die uns kontaktieren. Da habe ich inzwischen eine gewisse allergische Reaktion. Ich versuche dann herauszufinden, wie nahe diese Abteilungen tatsächlich am Business dran sind. Aus meiner Erfahrung sind 80 Prozent total irrelevant, was das Business anbelangt“, so Micko.
Sein Tipp: Bei der Lead-Generierung in den Geschäftsbericht des Corporates schauen. „Wenn da drinnen steht, dass das, was wir machen, für sie strategisch relevant ist, haben wir einen Anknüpfungspunkt und es ist nicht nur ein Hobby einer kleinen Innovationsabteilung, die mit ein bisschen R&D-Budget ausgestattet ist“, sagt der Gründer.
„Es braucht nicht unbedingt eine Innovationsabteilung“
Für Klara Dimmel ist bei diesem Thema klar: „Es braucht nicht unbedingt eine Innovationsabteilung, wenn die richtige Person im Unternehmen ist, die ein Problem lösen muss, für das die Technologie geeignet ist. Dann braucht es diese komplexen Strukturen oft nicht. Manchmal wird da zu kompliziert gedacht. Manchmal kann man die Lösung ja eins zu eins so nehmen.“
Eric Weisz berichtet von ähnlichen Erfahrungen: Es gebe ganz viele „Warriors“ innerhalb von Unternehmen, die oftmals ihre eigene Agenda haben. Diese könnten – ganz ohne Innovationsabteilung – eine Kooperation ins Rollen bringen. Doch Weisz warnt: „Die brauchen das Standing innerhalb des Unternehmens, dass am Ende nicht der Kopf rollt, wenn es schief geht.“
„Wichtig, alle unterschiedlichen Personen damit abzuholen, was man ihnen anbieten kann“
Antonella Cvrtak betont ebenfalls die Wichtigkeit der richtigen Ansprechpartner:innen im Corporate. Und die könne es auf mehreren Ebenen geben. Unterschiedliche Personen im Unternehmen würden dabei unterschiedliche Agenden verfolgen, etwa der/die Geschäftsführer:in auf der einen Seite und Werkleiter:innen – „die typischen nista-User“ – auf der anderen Seite. „Was uns da extrem geholfen hat, ist ganz nahe am Kunden zu sein und in den ersten Wochen diesen Change-Prozess, der mit Innovation einhergeht mitzuleiten und mitzugestalten“, sagt Cvrtak. „Es ist wichtig, alle unterschiedlichen Personen damit abzuholen, was man ihnen anbieten kann, und trotzdem beim Kernprozess zu bleiben.“
Und sie ergänzt: „Wir fragen die operativ verantwortliche Person auch immer, was sie von uns für das Gespräch mit dem Management braucht. Sollen wir mitgehen? Sollen wir Praxisbeispiele zum Herzeigen liefern?“ Schließlich wolle man auch dank dieser Unterstützung schlussendlich das OK bekommen.
3. | Hürden und der Clash of Cultures
Schon der vorangegangene Abschnitt zu den Voraussetzungen zeigt: Erfolgreiche Partnerschaften aufzubauen ist nicht leicht. Neben etwaigen fehlenden Voraussetzungen gibt es dabei noch ganz andere Hürden. Eine immer wieder genannte sind Unterschiede in der Unternehmenskultur. Nicht umsonst hat sich das Sinnbild des Speedboats, das auf den großen Tanker trifft, für die Kooperation zwischen Startups und Corporates durchgesetzt.
„Manchmal ist es auch gut, Barrieren zu haben“
Dabei sind Hürden nicht per se negativ, meint eFriends-Gründerin Dimmel: „Manchmal ist es auch gut, Barrieren zu haben, weil man dann auch über neue Lösungsmöglichkeiten nachdenkt. Auch wenn es schwierig ist, ist es oft gut, wenn es am Anfang nicht perfekt läuft und man daraus lernen kann“, so die Unternehmerin. Aus den Learnings entstünden dann auch neue Geschäftsmodelle.
Geschwindigkeitsunterschiede
Für Circly-Gründer Weisz ist dennoch klar: Die angesprochenen Geschwindigkeitsunterschiede haben Konfliktpotenzial – schon allein aus finanziellen Gründen. „Wir müssen schnell agieren, um zu überleben. Die Unternehmen müssen das meistens nicht“, meint Weisz. Die besorgte Frage seitens mancher Corporate-Verantwortlichen, „Gibt’s euch denn noch in einem Jahr?“, sei für ihn so gesehen auch nachvollziehbar, sagt der Unternehmer.
Bei bestimmten Prozessen sieht er mehr Effizienz-Potenzial, wie er aus seiner Erfahrung erzählt: „Manchmal muss man für einen kleinen Piloten ein 40-seitiges juristisches Dokument unterzeichnen.“ Die Verantwortlichen würden sich dann vielleicht sogar noch über die Projektkosten beschweren, gleichzeitig aber viel Geld in die Ausarbeitung durch ihre Anwälte stecken. „Da sage ich schon: Spart euch das doch, dann könnt ihr mit dem selben Budget drei solche Projekte umsetzen“, sagt Weisz und schießt nach: „Ich war schon zwei, drei Mal kurz davor, abbrechen zu wollen. Man steht sich so oft mit formellen Dingen selbst im Weg.“ Letztlich brauche es aber Verständnis für den jeweils anderen Part.
Erwartungsmanagement
Für Antonella Cvrtak braucht es auch deswegen „klassisches Erwartungsmanagement“. Sie empfiehlt, klein zu beginnen. „Wir gehen mit einem konkreten Proof of Concept hinein und starten bei einzelnen Standorten der Corporates. Dieses Risiko können sie gut nehmen und Budget dafür freigeben“, erzählt sie. Wenn es gut funktioniere, könne man einen großen Rollout machen. „So muss man nicht sofort Nein sagen, auch wenn es einmal komplizierter ist und länger dauert“, meint Cvrtak.
Braucht es direkten Zugang zum Management?
Martin Micko schließt beim Thema Hürden an die Thematik der richtigen Ansprechpartner:innen an. Man brauche einen direkten Zugang zu den entscheidenden Personen im Management, sagt der Gründer. „Ich finde, das ist das schwierigste: Herauszufinden, wer die wirklich relevanten Leute im Unternehmen sind.“ Seine Frage in der Lead-Qualifizierung, wenn ihn jemand aus einer Innovationsabteilung kontaktiere, sei daher: „Wie oft hast du einen Termin mit deinem Vorstand? Und wenn sich herausstellt, er hat keinen regelmäßigen Termin, ist das für mich ein Alarmsignal.“
Letztlich sei hin und wieder Absagen nicht schlecht. „Wir gewinnen dadurch Profil und es ist ganz klar, dass wir fokussiert sind.“ Denn: „Fokus ist letztlich the name of the game für Startups. Dementsprechend ist ‚Nein‘ Sagen einer der wesentlichsten Aspekte in einem erfolgreichen Startup“, meint Micko.
Eric Weisz hat beim Thema Zugang zum Management jedoch andere Erfahrungen gemacht, wie er berichtet: Es könne in seinem Fall eine längere Vorarbeit mit den Verantwortlichen brauchen, bevor das Projekt ins Management getragen wird – und dann komme trotzdem eine erfolgreiche Kooperation dabei heraus.
Sales-Prozesse standardisieren
Es gibt also unterschiedliche Zugänge, um zur Partnerschaft zu gelangen. Ein Tipp von Martin Micko gilt aber wohl unabhängig davon, welchen Weg man wählt: „Man muss Sales-Prozesse standardisieren und klar vordefinieren, um sie zu skalieren“, meint der Gründer. „Das ist ein total schmerzvoller Prozess. Das klingt alles so banal, aber erst wenn du das geschafft hast, beginnst du die Brücke zu schlagen zwischen Startup und Corporate. Aber gleichzeitig verlierst du dadurch Geschwindigkeit“, so Micko.
Ehrlichkeit
Antonella Cvrtak hat noch einen weiteren Tipp, um Hürden zu überkommen: „Man muss ehrlich und fundiert sein. Unsere Erfahrung ist, dass dann auch Ehrlichkeit vom Kunden kommt, welche Probleme es auf deren Seite gibt.“ Klara Dimmel schließt sich dem an: „Ehrlichkeit ist essenziell. Sonst geht es nach ein paar Monaten nicht mehr. Und es fehlt auch die Glaubwürdigkeit.“
Auch für Eric Weisz ist klar: „Immer ehrlich sein – mit offenen Karten zu spielen tut beiden gut.“ Er sieht daher auch den „fake it til you make it“-Ansatz in der Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates fehl am Platz. „Das kommt nicht aus der europäischen Kultur. In den USA wird es als keck angesehen. In Europa ist es anders.“ Man müsse ehrlich sein, um Vertrauen aufzubauen. „In unserem Markt der bessere Zugang, lieber etwas zu ehrlich zu sein. Wenn jemand dann sagt: Das ist mir zu wenig, dann kann man ihn disqualifizieren“, so Weisz
Martin Micko sieht hierbei aber nicht nur Startups in der Pflicht: „Ich würde mir die Ehrlichkeit und Transparenz, die wir Corporates geben, auch umgekehrt wünschen. Das würde uns auch in unserer eigenen Planung helfen.“ Und er hat noch einen Wunsch an Großunternehmen, um die Hürden in der Zusammenarbeit mit Startups zu minimieren: „Es braucht ein Verständnis von Corporates, dass Startups anderen Paradigmen unterworfen sind, wie etwa Investoren, die bestimmte KPIs erwarten.“
4. | Die Rolle von Corporate Venture Capital (CVC)
Ein entscheidender Aspekt der von Micko angesprochenen Planungssicherheit ist immer die finanzielle Seite. Und auch hier können Großunternehmen Startups über via Kundenbeziehung generierte Umsätze hinaus unterstützen. Denn ein zentrales Instrument im Corporate Venturing ist Corporate Venture Capital (CVC), wie in Folge 3 dieser Serie herausgearbeitet wurde.
„Ein sehr offener, ehrlicher Austausch mit irre viel Input“
Omnius hat solches Kapital von UNIQA Ventures im Rahmen seiner Zwölf-Millionen-Euro-Serie A-Finanzierungsrunde erhalten. Und nicht nur von diesem Corporate VC. „Wir haben auch andere Versicherungen mit kleineren Tickets bei uns drinnen. Es ist eine schöne Diversität, auch mit klassischen VCs“, erzählt Martin Micko. Daraus entstehe „ein sehr offener, ehrlicher Austausch mit irre viel Input“. „Es sind lauter Menschen aus der ganzen Welt, die uns irrsinnig viel Know-how mitgeben und wir sind sehr dankbar dafür, solche Partner zu haben“, meint der Gründer.
UNIQA Ventures habe seit dem Investment immer eine aktive Rolle gespielt und sei „ganz eng am Business dran“. „Und erst in diesem aktiven Zusammenspiel zwischen dem Investment-Arm und dem Business entsteht eine Kraft, in der etwas Neues entstehen kann und mit der man wirklich einen Mehrwert schaffen kann“, ist der omnius-Gründer überzeugt.
„Es ist schön, wenn man große Unternehmen hinter sich hat, die einem auch den Rücken stärken“
Klara Dimmel bringt einen weiteren Aspekt ein. Mit eFriends holte sie VERBUND X Ventures nicht nur als Partner, sondern auch als Investor an Bord. „Es ist schön, wenn man große Unternehmen hinter sich hat, die einem auch den Rücken stärken. In unserem Bereich muss man einen Energieanbieter-Wechsel machen und dafür braucht es Vertrauen in das Unternehmen“, erzählt sie.
Als Startup in dem Bereich habe man es nicht so einfach. „Man hat relativ viele Pflichten und muss sehr viele Sicherheiten hinterlegen. Wenn man natürlich im Hintergrund ein großes Unternehmen hat, das einem den Rücken stärkt, und man weiß, da ist jemand dahinter, der schaut auf dich, ist das sehr, sehr gut“, sagt Dimmel.
Du willst mehr wissen? Schau dir die ganze Folge an!
Die Serie wird von brutkasten in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung unserer Partner:innen produziert.