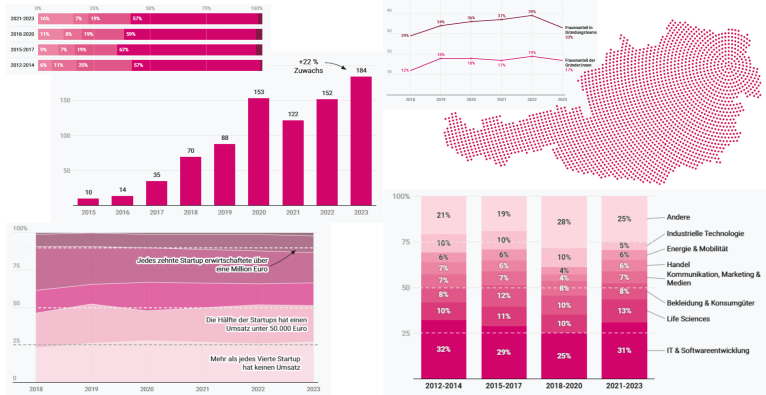✨ AI Kontextualisierung
Aus den meisten Urlaubs-Flirts entsteht nichts Ernsthaftes. Im Fall von Martin Klässer führte dagegen einer zu einem 250 Mio. Euro schweren Unternehmen. Zumindest indirekt. Der gebürtige Münchner war nach seinem Abitur in Österreich auf Urlaub – und lernte dort seine spätere Freundin kennen. Klässner entschied kurzerhand: Er zog zu ihr nach Österreich – “zumindest mal für das eine Jahr, bis sie mit der Schule fertig ist”.
Von der Millionenstadt München ging es ins 400-Seelen-Dorf Hüttau in Salzburg. Dort fing Klässner dann an, für Kunden Auftragsentwicklung zu machen. Die Beziehung zu seiner Salzburger Freundin überstand das angepeilte Jahr in Österreich nicht. “Aber nach einem Jahr war dann die Firma da. Ich habe Kunden gehabt und weitergemacht”.
Klässner blieb also in Österreich. Das ursprüngliche angedachte Studium der Elektrotechnik verwarf der Münchner wieder. “Ich bin dann eigentlich nie zu einer Ausbildung gekommen. Was dazu geführt hat, dass ich immer wieder Firmen gegründet habe, weil ich eine schwer vermittelbare Arbeitskraft bin”.
Klässner gründete zwei Wochen nach Insolvenz neu
Klässners Firma entwickelte Lösungen für Selbstbedienungsterminals – und setzte dann schon Projekte für BMW und Daimler um. Doch nicht alle angedachten Use Cases ließen sich umsetzen: Ein Pilotprojekt bei McDonald’s verlief im Sand: “Uns wurde erzählt, dass gedrucktes Hochglanzpapier das beste Medium sei, um einen Burger zu verkaufen”. Bildschirme oder Terminals werde es nie in McDonald’s-Filialen geben. “Heute gibt es nur Terminals. Wir waren wahrscheinlich einfach 20 Jahre zu früh an dem Thema dran”, sagt Klässner. Sein Unternehmen schlitterte schließlich in die Insolvenz.
Für Klässner aber kein Grund aufzugeben – ganz im Gegenteil: “Ich habe zwei Wochen nach der Insolvenz wieder neu gegründet”. Diesmal nahm Klässner einen Markt in den Blick, der ihn länger begleiten sollte: Elektromobilität.
Sein Ziel: Die Kenntnisse aus dem ersten Unternehmen nun auf diesen Markt zu übertragen. “Rückblickend war es wahrscheinlich auch hier zu früh”. In den Folgejahren kam jedoch Bewegung in den Markt. Klässner gründete dann ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Ladestationen spezialisierte – und verkaufte die Firma 2013. “Aus dem geringen Verkaufserlös hatte ich dann das Startkapital für has.to.be”.
has.to.be: “War einziger Anbieter, der ganz Europa mit einer Software-Plattform abbilden konnte”
has.to.be spezialisierte sich auf Software für Ladestationen für Elektroautos. Für Klässner gab es dabei zwei wichtige Faktoren: “Wir haben gesagt, unsere Software muss so gestaltet sein, dass sie klimaneutrale Mobilität unterstützt. Und der zweite wichtige Faktor in unserer Vision war, dass klimaneutrale Mobilität grenzüberschreitend ist”.
Das habe sich im Nachhinein auch als der wichtigste Aspekt herausgestellt: Das Unternehmen stellte bei seiner Software immer sicher, dass sie europaweit funktionierte. “Das war am Schluss der Grund, warum wir alle Großprojekte gewonnen haben. Wir waren der einzige Anbieter, der ganz Europa mit einer einzigen Softwareplattform abbilden konnte”. So habe sich das Unternehmen mit Sitz in Radstadt als Marktführer etablieren können.
Zu Beginn war dies jedoch noch nicht absehbar. Im Gegenteil: “Wir haben uns damals bei der Gründung extra für das kleinere Büro entschieden, das wir zur Auswahl hatten”. Was zur Folge hatte, dass das Jungunternehmen bereits nach neun Monaten wieder umziehen musste. Die Dynamik sei mit dem Marktwachstum gekommen, erinnert sich Klässner heute. Von einem Exit war damals noch nicht die Rede.
“Man muss eine Firma gründen, um sie groß zu machen”
Ausgeschlossen hatte Klässner einen Verkauf aber ebenso wenig: “Ganz am Anfang haben wir es ehrlich gesagt offen gelassen”, blickt der Gründer heute zurück. Eines der wichtigsten Learnings aus seiner Insolvenz sei gewesen, dass man wieder loslassen müsse. Daher hätten sich die Gründer nicht darauf versteift, das Unternehmen ein Leben lang zu halten. Ebenso wenig habe man sich aber zu Beginn das Ziel gesetzt, das Unternehmen unmittelbar wieder zu verkaufen.
“Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, eine Firma eben nicht zu gründen, um sie zu verkaufen. Sondern man muss eine Firma gründen, um sie groß zu machen”, sagt Klässner. Ein Verkauf sei dann ein möglicher oder logischer Schritt, der sich daraus ergebe. Ganz wichtig sei aber, die Zielsetzung klar zu machen: “Wir haben uns ganz klar die Vision gesetzt, dass wir Mobilität klimaneutral gestalten”.
Klässners Learning: Startups brauchen Cash-Reserven für mindestens ein Jahr
Ebenfalls von Anfang an klar war für Klässner, dass das neue Unternehmen über Cash-Reserven für mindestens ein Jahr verfügen müsse. “Sonst ist eine Firma meiner Meinung nach nicht mehr führbar”, sagt der Gründer. Dies sei das wichtigste Learning aus der Insolvenz seines früheren Unternehmens gewesen. has.to.be finanzierte sich im ersten Jahr “rein über einen positiven Cashflow”. Das Unternehmen war damals ausschließlich im Projektgeschäft tätig.
“Als es dann aber darum ging, international oder überhaupt mal nach Deutschland sinnvoll zu skalieren, haben wir sofort Investoren an Bord geholt, um immer ein Jahr Cash in der Hand zu haben”, sagt Klässner. Eine Kapitalrunde abzuschließen, dauere jedenfalls zwischen neun und zwölf Monaten. “Alles darunter ist unrealistisch”, sagt Klässner. Daher brauche man Cash-Reserven für ein Jahr: “Ansonsten muss man eine Kapitalrunde mit Druck machen”.
Auch bei has.to.be lief nicht jede Finanzierungsrunde völlig reibungslos: “Auch bei den Kapitalrunden, die wir gemacht haben, gab es immer auf den letzten fünf Metern irgendwelche Themen, die das nochmal um drei Monate nach hinten geschoben haben.” Wenn man diese drei Monate nicht als Spielraum habe, könnte auch bei einer gut vorbereiteten Kapitalrunde auf den letzten Metern Schluss sein.
Nach VW-Einstieg begannen Exit-Vorbereitungen
2019 stieg dann mit Volkswagen (VW) einer der größten Namen der Mobilitätsbranche beim Salzburger Startup ein. Für Klässner sei dies der Moment gewesen, an dem er sich gesagt habe: “OK, wir haben jetzt die bestimmende Mehrheit im Gesellschafterkreis mehr oder weniger verloren”. Die Folge: Er begann an einen Exit zu denken. “Ich bin immer nur selbstständig gewesen, wollte nie in Konzernstrukturen enden”, erzählt der Gründer. Klässners Schlussfolgerung: Nun war der Zeitpunkt gekommen, den Exit vorzubereiten. Dies tat er dann über die folgenden zwei Jahre.
In dieser Phase begann Klässner, sich operativ ersetzbar zu machen. Zu dem Zeitpunkt, in dem man in Verhandlungen einsteige, sollte die Firma so strukturiert sein, dass man als Gründer kein operatives Geschäft mehr habe, empfiehlt er: “Mein Ziel ist immer gewesen, dass ich zum Zeitpunkt des Exits in der Firma nicht mehr gebraucht werde.” Ab 2019 begann er, unterschiedliche Methoden zu entwickeln, um dies sicherzustellen. “Weil ich immer wollte, dass die Führungsebene unter mir plus die Mitarbeiter eigenständig Entscheidungen treffen können, die im Sinne der Strategie liegen”. Als Geschäftsführer müsse er dann nicht mehr miteinbezogen werden. “Nur dadurch habe ich die Zeit gehabt, mich überhaupt diesem Verkaufsprozess qualitativ widmen zu können”.
AOA statt OKR
has.to.be setzte dabei zunächst auf den populären Ansatz Objectives and Key Results (OKR). Es stellte sich aber heraus: Das System funktionierte für das Startup nicht. Also entwickelten Klässner und seine Mitstreiter einen eigenen Ansatz – genannt Art of Acceleration (AOA). Das Ziel dabei: “Wir müssen die Leute ermächtigen und ihnen ein Rahmenwerk geben, in dem sie frei entscheiden können. Dazu brauchen sie einerseits eine Shared Reality, das heißt sehr viel Kontextinformation. Und du brauchst ein Regelwerk, mit dem die Mitarbeiter gerne arbeiten und das sie unterstützt, aber nicht behindert”, erläutert Klässner. Innerhalb von neun Monaten wurde das System bei has.to.be implementiert. Mit Erfolg: “Ab Mitte 2020 haben wir ein Unternehmen gehabt, das ohne C-Level-Interventionen funktioniert hat”.
Für Klässner bedeutete dies: Zeit für die Exit-Gespräche. “Ich habe den Exit-Prozess bei uns intern fast komplett alleine gemacht”, erzählt der Gründer über die Verhandlungen mit dem späteren Käufer, dem US-Unternehmen ChargePoint. Unterstützung erhielt er im rechtlichen Bereich und bei der Due Diligence, “aber die Grundverhandlungen habe ich alleine gemacht”. Es flossen dabei über die Dauer von neun Monaten rund 60 Stunden pro Woche von Klässners Zeit hinein. “Das war ein absoluter Full-Time-Job”.
Klässner: Thema Steuern im Verkaufsprozess berücksichtigen
Learnings aus dieser Zeit hat Klässner mehrere: Wie bei Finanzierungsrunden brauche auch hier das Unternehmen ausreichend Cash-Reserven, um Drucksituationen zu vermeiden. “Du brauchst die Flexibilität, auch in Verhandlungen dreimal ‘nein’ sagen zu können”.
Außerdem sollten Gründer:innen im Verkaufsprozess das Thema Steuern berücksichtigen. “Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass es ausreichend Cash gibt, um die Steuer zu zahlen. Weil die ersten, die nach dem Verkauf anklopfen, sind die vom Finanzamt”. Hier braucht es Liquidität – denn die Steuerlast entsteht beim Closing – selbst, wenn der Kaufpreis ganz oder teilweise in Aktien des Käuferunternehmens bezahlt werde, wie es bei has.to.be der Fall war.
Ein weiterer Tipp von Klässner: Erfahrene, pragmatische Anwälte hinzuziehen. “Wenn die Gegenseite nicht pragmatisch ist, musst zumindest du pragmatische Lösungen auf den Tisch bringen”, erläutert er. Auch beim Notar sei Pragmatismus wichtig.
Verkauf für 250 Mio. Euro an ChargePoint dann besiegelt
Klässner einigte sich jedenfalls mit ChargePoint: has.to.be wurde für 250 Mio. Euro an das US-Unternehmen verkauft. Der Verkauf gilt als der größte Exit in der österreichischen Startup-Geschichte.
“Es war natürlich eine gewisse Erleichterung, weil die Verträge zumindest mal unterschrieben waren”, sagt Klässner heute. “Aber ein Deal ist eigentlich immer erst dann abgeschlossen, wenn das Closing vollzogen ist, die Shares eingebucht und das Geld am Konto ist”. Bis dahin könne noch viel schief gehen. Acht Wochen nach dem Signing erfolgte dann auch das Closing. Diese Wochen verliefen für Klässner “arbeitsintensiv, weil es noch sehr viel Dokumentation war, die man in dem Zeitraum aufbringen musste”, gleichzeitig aber war die Phase “vom Komplexitätsgrad nicht mehr so hoch”.
Das Closing selbst dauerte fast einen ganzen Tag – danach ging’s zum Essen mit Notar und Anwalt. “Das war dann eigentlich auch unsere Closing-Feier”, sagt Klässner. Schon am Folgetag ging es dann mit der Integration von has.to.be in ChargePoint los. Klässner wirkte daran noch mit. Mit den US-Käufern war vereinbart, dass er so lange in der Gesellschaft blieb, wie nötig. “Wir haben dann aber nach fünf Monaten identifiziert, dass es für mich eigentlich nichts mehr zu tun gab, weil wir unsere Firma so strukturiert haben, dass ich nicht gebraucht werden”. Nach den verschiedenen Übergabe-Prozessen “war ich fast nur noch noch zum Kaffee trinken in der Firma”. Klässner schied daraufhin operativ aus dem Unternehmen aus.
Fünf Monate Übergangszeit: “Die einzigen Monate, wo ich ohne Druck ins Büro ging”
Die fünf Monate Übergangszeit beschreibt Klässner im Nachhinein als schöne Zeit: “Das waren die einzigen Monate, wo ich ins Büro gegangen bin, ohne Druck gehabt zu haben.” Bei has.to.be hätten die Gründer von Anfang “jeden Tag Druck” gehabt. Der fiel nun weg. Klässner war in der Zeit der Übergabe wichtig, dass die Kultur von has.to.be erhalten blieb – und auch Angebote wie Kantine oder Kindergarten weiter bestehen. “Das meiste haben wir auch wirklich gut erreicht”, sagt er heute.
Nach seinem Ausstieg war für Klässner bald klar, dass er weiter unternehmerisch aktiv bleiben wollte: “Ich bin eigentlich immer Unternehmer gewesen, ich habe nichts anderes gekannt”. Durch einen Exit schaffe man für sich auch neue Möglichkeiten: Für Klässner etwa das Thema Startup-Investments. “Ich habe immer gerne mit jungen, motivierten Menschen gearbeitet, die selber die Motivation und den Druck gehabt haben, etwas zu bewegen”, erzählt Klässner.
Und so kam es zur Gründung der Investmentfirma make visions capital. Sie hat bisher Kapital in zwölf Startups gesteckt. Klässner und seine Partner verstehen sich dabei als aktive Investoren, die sich bei den jeweiligen Startups auch einbringen. Der Investment-Schwerpunkt liegt auf Software in Bereichen wie Life Sciences, Robotics und Energy. Make vision investiert dabei im Bereich von 250.000 bis 500.000 Euro pro Ticket – üblicherweise in der Pre-Seed-Phase. Für seine Startup-Investments wendet Klässner aktuell 50 Prozent seiner Zeit auf.
Klässner will es mit GrowthSquare noch einmal wissen
Und die restlichen 50 Prozent? Klässner hat wieder gegründet. Sein neues Startup GrowthSquare entwickelt die bei has.to.be entstandene Management-Methodologie, Art of Acceleration (AOA), weiter und bringt sie zur Anwendung. Mit seinem neuen Unternehmen denkt Klässner ebenfalls wieder ambitioniert: “Natürlich ist die Motivation da, GrowthSquare wieder zu einer großen Company aufzubauen. Auch aus einem gewissen Ego-Gedanken heraus”.
Was Klässner damit meint: “Ich möchte für mich selber sehen: War has.to.be ein Glücksfall, den wir erfolgreich geritten und bei dem wir zufällig die richtigen Entscheidungen getroffen haben? Oder sind wirklich diese Methodologie, diese Umsetzung und diese Themen das Erfolgskriterium, um vielleicht wieder den dann größten Exit zu generieren?” Klässner gibt auch gleich selbst die Antwort: “Wir werden es wahrscheinlich in sieben bis zehn Jahren sehen”.