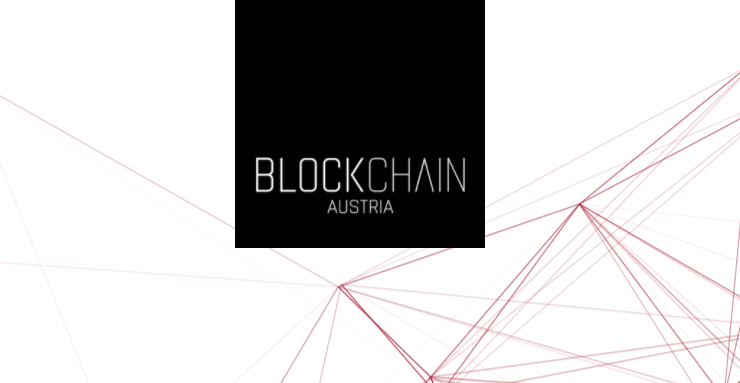✨ AI Kontextualisierung
„Wir müssen schnell sein. Wer zögert, hat verloren!“ warnt Wirtschaftsminister Harald Mahrer auf der Website der neuen Plattform Blockchain Austria. Dazu wird auf der Seite die passende Statistik geliefert: Das World Economic Forum prognostizierte demnach, dass schon im Jahr 2025 insgesamt zehn Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts mit Hilfe der Blockchain-Technologie abgewickelt werden. „Wenn wir uns heute nicht mit derartigen Technologien beschäftigen, tun es andere“, heißt es abschließend.
+++ FH-Ausbau: 5000 zusätzliche Fachhochschul-Plätze in MINT-Fächern +++
Experten aus mehreren Teilbereichen beteiligt
Genau diese Beschäftigung mit dem Thema wollen Minister Mahrer und das Wirtschaftsministerium (BMWFW) nun forcieren. Denn es gebe kein sichereres oder transparenteres System, um Daten zu verwalten, schreibt Mahrer. Für die Plattform Blockchain Austria wurden einige ausgewiesene Experten unterschiedlicher Teilbereiche als Partner gefunden. So sind etwa Blockchainhub Graz, die Forschungseinrichtung SBA Research und die Anwaltskanzlei Stadler Völkel beteiligt. Die Plattform verfolgt mehrere (mehr oder weniger) konkrete Ziele. Dazu wird mit einem „9 Punkte Plan für Österreich“ eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt:
1. Durchführung von Pilotprojekten & Einrichtung von Sandboxes: Es sollen „Leuchtturmprojekte“ gefördert werden. Für sie soll ein geschützter Regulierungsrahmen („Sandbox“) geschaffen werden.
2. Förderung von bestehenden Aktivitäten der Zivilgesellschaft: Bereits bestehende Infrastruktur soll finanziell unterstützt und die Organisation und Dokumentation von Konsortien bei einer existierenden oder neuen Institution sichergestellt werden.
3. Interdisziplinäre nachhaltige Forschungseinrichtungen: Es sollen permanente Forschungsplattformen an verschiedenen Universitäten eingerichtet werden. Diese sollen einen weiteren „Brain-Drain“ aus Österreich verhindern.
4. Systematische Ausbildung von Fachkräften: Lehrgänge, Postgraduate Studiengänge und einschlägige Kurse für betroffene Fachkräfte sollen erarbeitet werden.
5. Blockchain Informationsplattform: Es soll eine zentrale Plattform zur Koordination der Wissensweitergabe von und für lokale und nationale Experten geschaffen werden. Sie soll die Informationsströme der momentan vielen kleinen Interessensgemeinschaften zusammenführen.
6. Austrian Krypto-Report: Es soll ein „ausführliches und vollständiges dynamisch wachsendes Nachschlagewerk“ geschaffen werden. Das soll die Informationsweitergabe erleichtern und die internationale Sichtbarkeit erhöhen.
7. Bürgerservice für Blockchain-Themen und Kryptowährungen: Es soll ein „Bürgerservice“ eingerichtet werden, das Expertenwissen von einer zentralen Stelle gebündelt weitergibt und als Sprachrohr für Blockchain-Angelegenheiten und Kryptowährungen dient.
8. Austrian Blockchain Cluster (ABC): Alle „nötigen Akteure“, sowohl aus dem öffentlichen als auch dem privaten Bereich sollen vernetzt werden. Damit soll Wissen vor allem im Bereich Kryptorecht generiert werden. Die „ABC–Gruppe“ ist als „finanziell und organisatorisch unabhängige Einrichtung“ angedacht, die mit Politik und Verwaltung zusammenarbeitet.
9. Institutionelle Task Force: Eine interdisziplinäre Taskforce von Politik und Verwaltung soll den Counterpart zum unabhängigen Cluster bilden. Dieser sollen Vertreter von Bund, Ländern und Kammern, aber auch Experten und Corporates angehören. Das BMWFW will dabei den Lead übernehmen.
Umsetzung könnte an politischer Situation scheitern
Wie viel Chance auf Umsetzung der „9 Punkte Plan“ hat, ist gerade knapp vor der Nationalratswahl freilich fraglich, handelt es sich dabei doch nur um eine Art Positionspapier. Gerade die von Minister Mahrer eingemahnte schnelle Umsetzung von Maßnahmen könnte an der politischen Situation scheitern. So sind von der mehr oder weniger geplatzten rot-schwarzen Koalition vor der Wahl im Oktober kaum noch Beschlüsse zu erwarten. Hinzu kommt die derzeitige Sommerpause des Nationalrats, die notwendige schnelle Gesetzesänderungen ohnehin verunmöglicht. Natürlich wären einige Punkte, etwa jene zu Informationsplattformen und -Netzwerken, auch ohne Nationalratsbeschluss realisierbar. Doch auch hierfür wäre letztendlich die Zusammenarbeit politischer Akteure mit Teilen der Verwaltung notwendig. Wie in vielen Bereichen bleibt also für das Gros des vorgelegten Plans abzuwarten, wie sich die neue Regierung nach der Wahl im Oktober positioniert und welche Akteure dann am Ruder sind.