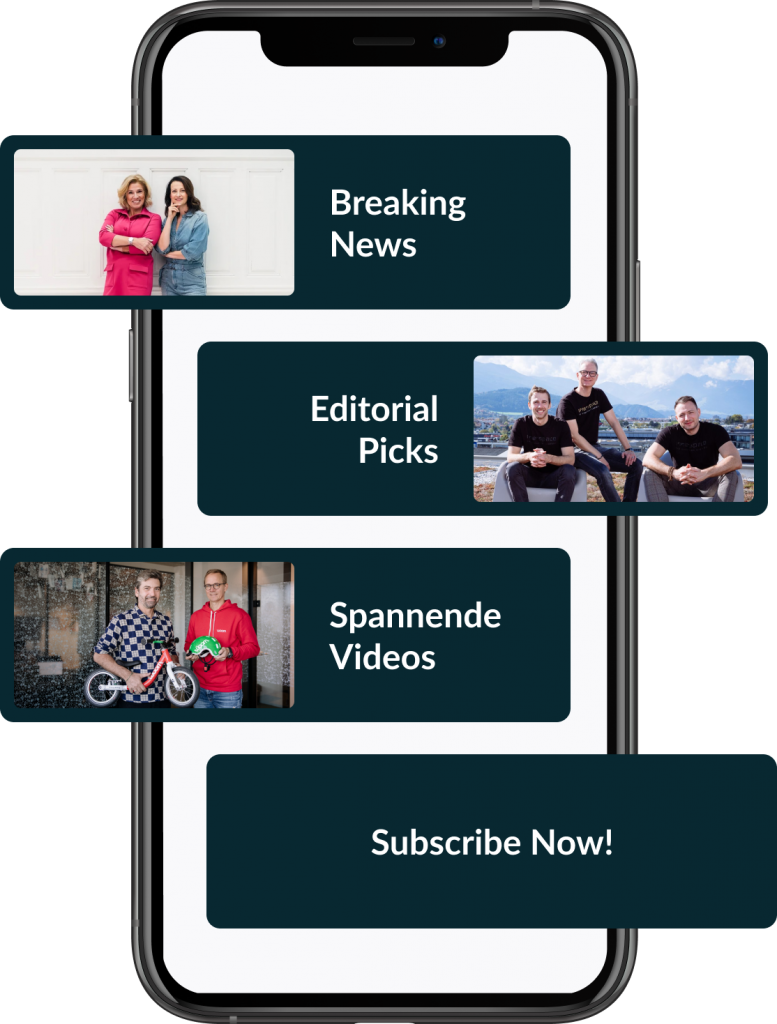✨ AI Kontextualisierung
Den Startup-Hype nützen, um sich neue Ideen zu holen: Das ist derzeit für viele große Unternehmen das Rezept der Wahl. In Deutschland ist es schon länger so: Der Technologiekonzern Siemens etwa kooperiert schon seit 1999 mit Startups und investierte seither rund 800 Millionen Euro in junge Unternehmen. In Österreich ist dieser Trend etwas später angekommen. „Dafür geht es jetzt mit Raketengeschwindigkeit los“, sagt Julian Kawohl, der an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin die Beziehungen zwischen Startups und Konzernen erforscht.
Auch eingesessene Platzhirsche wie der heimische Energiekonzern Wien Energie springen jetzt auf den Zug auf – weil sich der Energiemarkt im Umbruch befindet, die Kunden anspruchsvoller werden und auch branchenfremde Anbieter in den Markt drängen. Kurz: Einfach nur Strom zu liefern reicht heutzutage nicht mehr. „Unser Ziel ist es, innovativer zu werden“, sagt Lorena Skiljan, die bei Wien Energie für Startups zuständig ist. In der Theorie klingen diese Kooperationen gut: Die Jungunternehmer bringen mit ihrem Gründergeist frischen Wind in die oft träge gewordenen Konzernstrukturen und verleihen ihnen das Prädikat „innovativ“. Die Startups erhalten im Gegenzug wertvolle Expertise, Geld, Infrastruktur und Zugriff auf die etablierten Netzwerke der Corporates, deren Vertriebsstrukturen und Kunden – eine echte Win-win-Situation. Aber funktioniert das auch in der Praxis? Profitieren tatsächlich beide Seiten von der Zusammenarbeit? Und bekommen am Ende alle das, was sie sich erhofft haben?
Entwicklung
Stefan Ponsold kennt beide Seiten. Nach der HTL-Matura arbeitete er einige Jahre in großen Konzernen,am Schluss leitete er die Abteilung für Forschung und Entwicklung der UmdaschAG. Mit 26 Jahren machte er sich selbstständig, kurz darauf kündigte er seinen gut bezahlten, sicheren Entwicklerjob. Seine Firma „Sunnybag“ produziert Rucksäcke und Taschen mit integrierten Solarzellen, mit denen sich Smartphones, Laptops und Tablets unterwegs umweltfreundlich aufladen lassen. Die sechs Mitarbeiter starke Firma mit Sitz in Graz hat sich auf dem Markt schon behauptet: „Wir sind mittlerweile profitabel“, sagt Ponsold stolz.
Feedback von großen Partnern
Sunnybag arbeitete von Anfang an mit „Corporates“ zusammen – mit Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und dem SOS Kinderdorf etwa, oder mit dem oberösterreichischen Motorradhersteller KTM. Für Ponsold war die Zusammenarbeit mit etablierten Organisationen immer gewinnbringend. „Was du auf jeden Fall immer bekommst, ist Feedback, wie gut das Produkt funktioniert“, sagt er. Etwa im Fall von Ärzte ohne Grenzen: „Die Taschen werden unter Extrembedingungen in Krisengebieten getestet. Das könnten wir in Österreich gar nicht. Wir können unsere Produkte dadurch ständig verbessern“, sagt Ponsold. Für KTM stellt Sunnybag Outdoorrucksäcke her. Auch das ist ein Gewinn für das junge Unternehmen. Sunnybag hat damit auf einen Schlag auch die KTM-Kunden an der Hand – wohl mehr, als man in dieser kurzen Zeit über den eigenen Shop erreicht hätte.Und genau darum geht es: schnell Zugang zu möglichst vielen Kunden zu erhalten. Startups sind reich an Ideen und gut darin, sie weiterzuentwickeln. Auch Geld ist nicht unbedingt die rarste Ressource – Investoren, die bereit sind, gute Ideen zu finanzieren, gibt es nicht zu knapp. Die Herausforderung ist, das Produkt möglichst schnell unter die Leute zu bringen.
Startup-Unit als “CEO-Toy”?
„Das ist ja der Unterschied zwischen einem Startup und einem Handwerksbetrieb: Startups wollen schnell hohe Wachstumsraten erreichen. Dafür brauchen sie erst einmal einen Kundenstamm, um zu beweisen, dass die Idee marktfähig ist“, sagt Julian Kawohl. Derzeit sei „viel Aktionismus“ im Markt, sagt Kawohl. Wenn sich Konzerne medienwirksam mit Startups beschäftigen, bestehe immer die Gefahr, dass die Startup-Unit in der äußeren Wahrnehmung zum „CEOToy“ verkomme. Um diesen Eindruck zu widerlegen, muss der Konzern dem Startup dauerhaft genug Aufmerksamkeit widmen, damit es gedeihen und die ihm zugedachte Rolle spielen kann. „Wenn das nicht gegeben ist, brauchen sich die Unternehmen über den Eindruck, das Ganze sei nur ein Imagethema, nicht zu beschweren“.
Es geht um das Netzwerk
Startups wollten von Corporates zwei Dinge: Expertenwissen und Zugang zum Kundennetzwerk. Alles andere könnten sie auch woanders bekommen. „Das Versprechen, das Corporates geben, klingt extrem charmant“, sagt Kawohl. „Theoretisch könnte das Corporate auf einen Schlag viele Kunden zur Verfügung stellen. Aber es geht auch ein großes Risiko ein, wenn es dem Startup erlaubt, seine Ideen an treuen Kunden auszuprobieren.“ Startups leben von der Schnelligkeit, sie testen ihr Produkt in der Regel im laufenden Betrieb. „Für Corporates, die darauf konditioniert sind, Fehlervermeidung um jeden Preis zu betreiben, ist das eine Kulturrevolution.“
Redaktionstipps
Das Corporate habe immer Angst, dass das auf die eigene Reputation zurückfalle. Kawohl rät großen Unternehmen dennoch, das Risiko einzugehen: „Genau das die Chance. So komme ich außerhalb der Konzernmauern schnell auf neue Ideen.“ Bislang bestünden die meisten Verbindungen allerdings noch zu kurz, als dass man deutliche Erfolge registrieren könne. Oft werde der Fehler gemacht, dass die Ziele der Kooperation nicht klar genug definiert seien. „Dann ist es schwierig, eine Erfolgsstory zu kreieren.“ Ein positives Beispiel sei der Accelerator des deutschen Privatsenders ProSieben- Sat.1. Startups, die daran teilnehmen, bekommen nicht Geld, sondern mediale Aufmerksamkeit in Form von Werbezeit auf den Kanälen der Sendergruppe. Der Online-Sexshop Amorelie etwa konnte so rasch auf eine Größe von über 100 Mitarbeitern wachsen. Pro 7 habe mittlerweile die Mehrheit an Amorelie übernommen.
Von Kampagnen gelernt
Auch für Sunnybag- Gründer Ponsold waren Medien bislang der wichtigste Kanal, um potenzielle Kunden anzusprechen: „Die Presse ist das Allerwichtigste, um Aufmerksamkeit für die Marke zu bekommen“, sagt er. Geld für Marketing und Anzeigen sei, wie bei den meisten Startups, nämlich kaum da. Auch Crowdfunding sei eine rasche und effiziente Möglichkeit, das Produkt zu bewerben und gleichzeitig zu testen, ob es dafür einen Markt gibt. „Wir haben immer wieder Kampagnen auf Kickstarter gemacht und schon so manche Lernkurve bekommen“, sagt Ponsold. Gerade habe man für ein spezielles Produkt für Bergsteiger 70.000 Euro eingesammelt, ausgegangen war man von 22.000 Euro. Auch das Gegenteil hat er schon erlebt: dass er mit einem riesigen Erfolg rechnete, dann aber viel weniger hereinkam. Da sei er froh gewesen, dass er erst einmal das Interesse ausgelotet habe, bevor er 1000 Stück produzieren ließ. Aber Crowdfunding, sagt Ponsold, habe auch einen Nachteil: „Man steht auf der Bühne im Schweinwerferlicht.“ Wenn das Produkt nicht so gut ankomme, sei das auf ewig im Internet einsehbar. Gerade für Firmen, die sich selbst für sehr wertvoll halten, sei das ein großes Risiko.
Auch Klinkenputzen funktioniert noch
Fortgeschrittenere Startups sind auf Crowdinvesting-Plattformen besser aufgehoben. Zum Beispiel auf Green Rocket: Die Plattform hat sich auf die Themen Energie, Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit spezialisiert. „Von veganen Nudeln bis zur Nano-Beschichtung für Solarzellen haben wir schon alles gehabt“, sagt Gründer und CEO Wolfgang Deutschmann. Die Firmen auf Green Rocket schreiben in der Regel schon 50.000 bis 100.000 Euro Umsatz, die größte lag bei zwei Millionen Euro. Das Mindestinvestment beträgt 250 Euro. Im Durchschnitt sammeln die Firmen 230.000 Euro ein. „Einige nützen die Kampagnen auch als Kundenbindungsinstrument“, sagt Deutschmann; etwa, indem sie den Investoren zusätzlich zu den Beteiligungen lebenslange Rabatte in ihren Online-Shops gewähren oder Gutscheine ausgeben. „So kann man Crowdfunding auch umsatzwirksam machen“, sagt Deutschmann.
Sonst funktioniert immer noch das gute, alte Klinkenputzen. Sunnybag-Gründer Ponsold kam so an seine ersten Kunden: Er rief ganz einfach bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen an und fragte, ob sie Interesse an seiner Solartasche hätten. Der Mut zahlte sich aus: Sie kauften um 25.000 Euro bei ihm ein. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte war geschrieben.