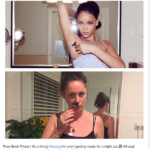✨ AI Kontextualisierung
Es ist gerade ein paar Wochen her, dass das burgenländische Logistik-Unternehmen Triworx erfolgreich seine Sanierung abschloss. Die Geschichte beginnt jedoch schon im Jänner 2017 an einem Sonntagvormittag. Damals ging die Lagerhalle des Unternehmens in Flammen auf. Gründer und CEO Josef Zbytovsky macht die Dimensionen klar: „Wir versenden 10.000 Paletten und 150.000 Pakete im Jahr. Wir haben im Durchschnitt 6500 Paletten auf Lager – mit einem Warenwert von rund fünf Millionen Euro. Das war mit 500 Einsatzkräften der größte Feuerwehreinsatz in der Geschichte des Burgenlands. Der Vollbrand dauerte 46 Stunden. Nach 72 Stunden konnte ‚Brand aus‘ vermeldet werden“.
+++ Startup-Finanzierung: 5 Mythen über Factoring +++
5 Mio. Euro Schaden nach skurriler irrtümlicher Brandstiftung
Schuld an dem Brand war nicht etwa eine Verfehlung im Sicherheits-Bereich. „Ein unternehmensfremder Mann wollte an der Außenseite der Halle Wasser anzapfen. Da die Wasserversorgung im Außenbereich jedoch wie jeden Winter abgedreht war, dachte er, die Leitung wäre bei minus zehn Grad eingefrorern. Er wollte sie mit einem Gasflämmer auftauen. Der Mann wurde inzwischen zu einer kleinen Strafe verurteilt“, erzählt Zbytovsky. Rund 4,5 bis 5 Millionen Euro Schaden seien bei dem Großbrand insgesamt entstanden. „Das war heftig, aber wir dachten, ausreichend versichert zu sein“, sagt der Triworx-Gründer.
Insolvenzantrag trotz Gewinnen bei Triworx
Und so habe die Bank problemlos diverse Finanzierungen in entsprechender Höhe gewährt, die mit den Ratenzahlungen der Versicherung zurückzuzahlen waren, und Zbytovsky und sein Team konnten den Normalbetrieb nach einigen Monaten wieder aufnehmen. „Alles lief wieder gut und das Unternehmen warf Gewinne ab, bis die Versicherung im März 2019 die letzte Rate an die Bank überwies“, erzählt der Gründer. Denn nach dieser letzten Rate blieb ein Gap von rund 250.000 Euro übrig. „Die Bank traute uns nicht zu, dass wir das stemmen können, fror unsere Konten ein und stellte auch die anderen laufenden Kredite fällig. Daraufhin hatten wir nur die Möglichkeit einen Insolvenz-Antrag zu stellen”, erzählt Zbytovsky.
„Guten Sanierer ins Boot geholt“
Zusammen mit sämtlichen offenen Rechnungen sei so ein Insolvenz-Volumen von rund 650.000 Euro zustande gekommen. „Dabei hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch etwa 350.000 Euro offene Forderungen gegenüber Kunden. Wir waren also nicht schlecht aufgestellt. Wir haben uns sofort einen guten Sanierer ins Boot geholt. Der versuchte zunächst noch, mit der Bank zu vermitteln, biss aber auf Granit“, erzählt der Gründer. Triworx brachte also einen Antrag auf Sanierungsverfahren ein – mit 20 Prozent Rückzahlungsziel. Der wurde angenommen.
Factoring: Offene Forderungen als Trumpf
Zum Trumpf wurden dabei die erwähnten offenen Forderungen gegenüber Kunden. „Wir haben ca. 200.000 Euro Monatsumsatz. Es war klar: Wenn wir ohne Zahlungsziel darauf zugreifen können, sind wir sofort wieder liquide. Daher haben wir uns, auch auf anraten des Sanierers, für Factoring beim Anbieter SVEA entschieden“. Beim Factoring zahlt der „Factor“, in diesem Fall SVEA, die offenen Rechnungen sofort an den Auftragnehmer aus und übernimmt gegen eine Gebühr deren Fälligstellung beim Auftraggeber.
3 Monate: Sanierung „in Rekordzeit“
Damit sei die Sanierung „in Rekordzeit“ gelungen. „Es waren genau drei Monate von der Fälligstellung der Kredite durch die Bank bis zum formellen Abschluss des Sanierungsverfahrens. Jetzt zahlen wir noch zwei Jahre unsere Raten. Dann wird der Sanierungsvermerk auch wieder aus dem Firmenbuch gestrichen“, sagt der Gründer.
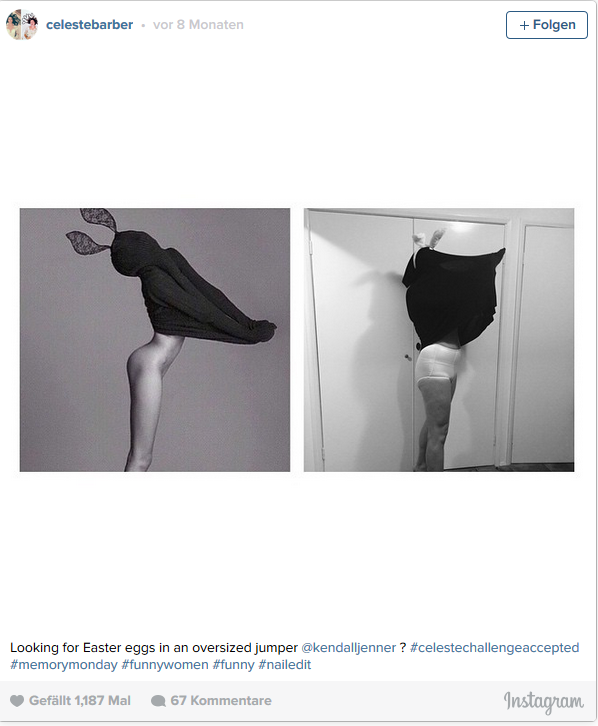
„Will weiter auf (selektives) Factoring setzen“
Auch nach der erfolgreichen Sanierung will man weiter auf Factoring setzen. Für Triworx habe sich vor allem das „selektive Factoring“, das SVEA im Gegensatz zu den meisten Anbietern am Markt anbietet, bewährt, sagt Zbytovsky. Dabei kann man von Rechnung zu Rechnung entscheiden, ob sie vom Factor übernommen werden soll, oder nicht. „Wir haben bei manchen Kunden ein Zahlungsziel von bis zu drei Monaten. Andere zahlen grundsätzlich innerhalb von drei Tagen, nachdem wir die Rechnung stellen. Bei denen würde es für uns überhaupt keinen Sinn machen, sie ins Factoring hereinzunehmen“, erklärt Zbytovsky. Aktuell würde man 75 Prozent der Rechnungen mit SVEA factoren.
„Steige unterm Strich besser aus“
„Das bietet einen weiteren riesigen Vorteil. Ich brauche jetzt keinen Kontorahmen mehr bei der Bank. Man darf nicht vergessen, dass man dort ja Überziehungszinsen zahlt und, wenn man beim Kunden in Vorleistung geht, ebenfalls Rechnungen zessieren muss“, sagt Zbytovsky. Wegen der durch das Factoring erhöhten Liquidität könne er nun dafür in Vorauskasse bezahlen und sich damit Sconti holen. „Wenn ich das alles gegenrechne steige ich mit Factoring unterm Strich finanziell besser aus, da mir ja auch sonstige Finanzierungskosten wegfallen, weil ich keine Kredite mehr brauche“.
Factoring von SVEA „jedenfalls die wirtschaftlichere Variante“
Für den Triworx-Gründer ist daher klar: „Wenn ich heute neu starten würde, würde ich es von Beginn an mit Factoring anstatt mit einem Kontorahmen machen. Wenn man potente Kunden hat, ist das jedenfalls die wirtschaftlichere und insgesamt bessere Variante“. und von diesen potenten Kunden hat Triworx viele: Unternehmen wie die Groupe PSA (Anm.: der Autokonzern hinter Peugeot, Citroën und Opel u.a.), Rewe, Mondi, Novartis oder die Raiffeisen Bausparkasse setzen auf den Logistik-Spezialisten.
⇒ Zur Page des Factoring-Anbieters SVEA