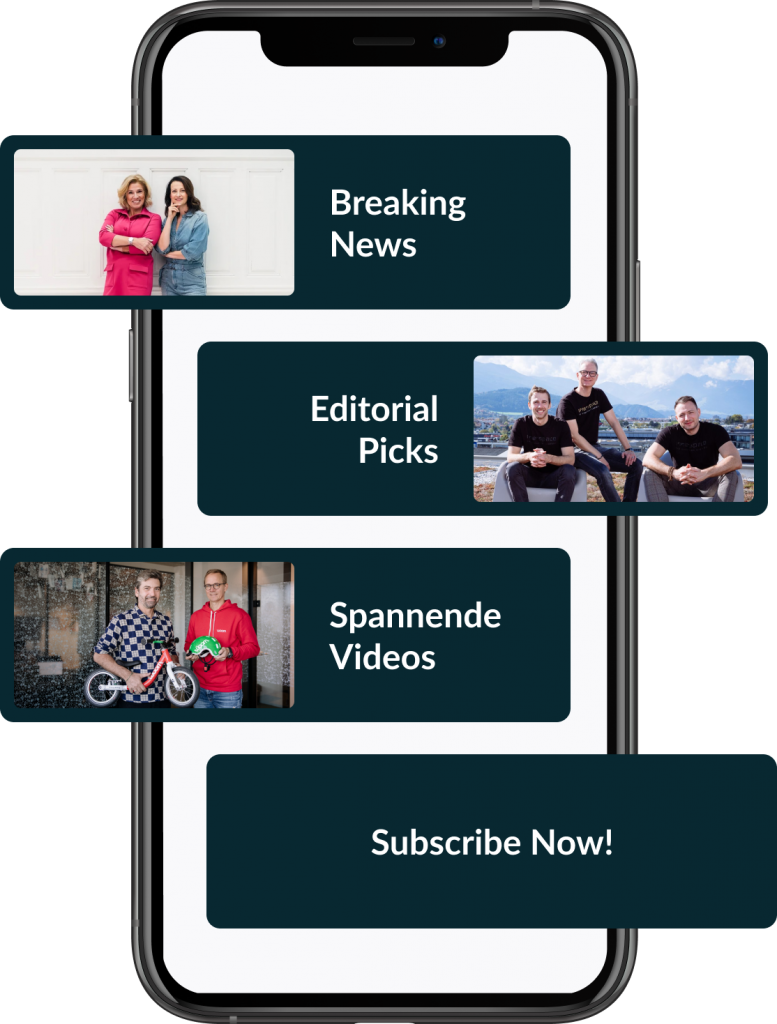✨ AI Kontextualisierung
Die Medizinprodukt-Industrie steht vor großen Herausforderungen aufgrund der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR – Medical Device Regulation), die heuer schlagend werden sollte, aber bis zum 31. Dezember 2027 verlängert wurde. Davon sind hierzulande zahlreiche Startups, wie etwa digitale Health-Apps, betroffen.
Das Europäische Parlament hat konkret im Frühjahr 2023 die Übergangsfrist für die vollständige Anwendung der MDR verlängert, um den Übergangszeitraum aufgrund massiver Bedenken – und Drängen der Europäischen Kommission – hinsichtlich Versorgung mit Medizinprodukten, Kapazität der zertifizierenden Stellen und Bereitschaft der Hersteller auszudehnen.
Ergänzung: Die Verlängerung ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und betrifft nur die Medizinprodukte, für die derzeit bereits ein Übergangszeitraum gilt, etwa Herzschrittmacher oder Spritzen. Somit betrifft die Verlängerung des Übergangszeitraums nur ältere Produkte, also solche, für die eine vor dem 26. Mai 2021 gemäß den Richtlinien 90/385/EWG oder 93/42/EWG des Rates ausgestellte Bescheinigung oder Konformitätserklärung vorliegt. Außerdem wird die Anwendung der verlängerten Übergangszeiträume von mehreren kumulativen Bedingungen abhängig gemacht, damit die Zeiträume nur für Produkte verlängert werden, die sicher sind und für die die Hersteller bereits Maßnahmen zum Übergang zur Verordnung über Medizinprodukte ergriffen haben.
Wichtigste Regeln der MDR
- Die Klassifizierung von Produkten hat sich geändert, was zur Folge hat, dass manche Produkte in eine neue Klasse geraten.
- Klinische Daten zur Bewertung von Leistungserbringung der Produkte sind umfangreicher geworden.
- Dokumentation muss aktuell gehalten werden.
- Neue Regelungen zur Post-Market-Surveillance.
- Ein Medizinprodukt muss verpflichtend identifiziert und registriert werden (UDI: Unique Device Identification).
- Hersteller müssen über eine verantwortliche Person verfügen, auch “Person Responsible for Regulatory Compliance” (PRRC) genannt.
- Zulassungsstellen werden europaweit vereinheitlicht.
- EUDAMED, eine europäische Datenbank, wird öffentlich zugänglich sein. Dort finden sich Informationen über Hersteller, Produkte, Bescheinigungen und klinische Prüfungen. Sie erlaubt es künftig einzusehen, welches Produkt mit welcher Datenlage und von wem auf dem Markt gekommen ist. Etwas, was sich jetzt noch als sehr undurchsichtig erweist.
- Spezifische Anforderungen für Händler und Händlerinnen.
Die Datenaufgabe
Trotz nochmaliger Schonfrist gilt es, enorme Hürden zu bewältigen und vor allem die Frage zu klären, wer sich überhaupt zertifizieren lassen muss.
Die EU-Medizinprodukteverordnung (MDR), auch bekannt als Verordnung (EU) 2017/745, verlangt eine klinische Evidenz für die Leistung und Sicherheit der Produkte. Dabei sind die Anforderungen der klinischen Bewertung umso höher, je höher die Risikoklassifizierung ist.
Ghazaleh Gouya-Lechner, Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie und klinische Pharmakologie sowie Gründerin von Gouya Insights GmbH mit Sitz in Wien, streicht eine der wichtigsten Punkte der MDR heraus: “All jene, die ‘Fühlen’, ‘Funktionieren’ und ‘Überleben’ am Menschen als Kriterien für ihr Produkt haben, benötigen klinische Daten.”
Was sind klinische Daten?
Erklärung: Gute klinische Praxis ist die Grundlage der Standards, nachdem die klinischen Studien durchgeführt werden müssen. Es sind keine “Phasen 1, 2 und 3” wie bei Arzneimitteln notwendig, allerdings muss man die klinische Zulassungsstrategie bei Medizinprodukten datenbasiert darstellen können, um auch mit nur einer einzigen klinischen Studie die Zulassung bzw. den CE-Markt (Anm.: Richtlinienverordnungsnummer 93/42/EWG) zu erlangen.
Voraussetzung für die Zulassung jener Medizinprodukte, die einen Einfluss darauf haben, wie sich ein Mensch „fühlt, funktioniert oder überlebt“ sind klinische Daten, die in einer Studie systematisch erhoben sind. Die Anzahl der Patienten ist nicht vorgegeben.
Mangelnde Erhebung der Sicherheit und Leistungsdaten von Produkten haben in der Vergangenheit gezeigt, welche massiven Auswirkungen diese auf Menschen haben können. Gouya-Lechner nennt zwei Beispiele:
- Brustimplantate eines französischen Herstellers, deren Hülle gebrochen ist und sich somit das Silikon im Körper von vielen Frauen ausgebreitet hat.
- Hüftimplantate sind gebrochen, da diese nie getestet wurden (wohl an Simulatoren, aber nicht am Menschen) und somit keine klinischen Daten vorliegen.
Die Klassenfrage
Ebenfalls geändert haben sich Klassifizierungsregeln. Eine neue Regel besagt, dass Software, die dazu gedacht ist, Informationen zur Verfügung zu stellen, um Entscheidungen mit Bezug zu Diagnosen oder Behandlungen zu treffen, in die “Klasse IIa” fällt. Es sei denn sie könnte direkt oder indirekt den Tod oder irreversible schwere Gesundheitsstörungen verursachen: dann fällt sie in “Klasse III”.
Droht die Gefahr einer ernsten Gesundheitsstörung oder einer Operation: dann fällt sie in “Klasse IIb”. Software, die dazu gedacht ist, physiologische Prozesse zu überwachen, fällt in “Klasse IIa”, es sei denn, dass Veränderungen von Vitalparametern zur unmittelbaren Gefahr für den Patienten werden können. Dann ist diese Software in “Klasse IIb” einzuordnen. Hier das Handbuch zu Klassifizierungsanfragen der EU.
Ablehnungsgründe von den zulassenden Stellen bei der Zertifizierungseinreichung der Medizinprodukte sind folgende: keine nachvollziehbare Methodik bei der Durchführung und Erhebung von klinischen Daten, fehlende Evidenz zur Sicherheit und Leistung insbesondere bei Nutzung der Real-World Daten (RWD), unsystematische Methodik der klinischen Bewertung und der Literatursuche und damit fehlende Darstellung der klinischen Evidenz.
Technische Erfordernisse nicht genug
Soviel zur Theorie. Bei Gouya-Lechner gehen indes in den letzten Wochen aus der Praxis (auch von Startups im Health-Bereich) verstärkt Anfragen zur Zulassung von Medizinprodukten ein, da für viele Unternehmen absolut unklar ist, ob deren Produkte von der MDR betroffen sind oder nicht. Durch ihre mehr als 20-jährige Erfahrung in der klinischen Forschung kennt sie die Herausforderungen der klinischen Produktentwicklung und die gesetzlichen Vorschriften dahinter.
“Man braucht klinische Daten aus Studien, um Sicherheit nachzuweisen”, sagt Gouya-Lechner. “Ein Hüftimplantat etwa kann nicht auf den Markt kommen, weil es nur die technischen Erfordernisse erfüllt. Die Leistung des Medizinproduktes muss in Studien überprüft und nachgewiesen werden können. Aber die sind zeit- und kostenaufwendig, teilweise fehlt die Grundexpertise in Europa dafür.”
MDR setzt Zulassungsstellen unter Druck
Damit spielt die Medizinerin nicht nur auf mangelnde Planung von Gründerinnen oder fehlende Geduld von Kapitalgebern an, dazu später mehr, sondern auch auf Zulassungsstellen, die erst “aufholen” müssen, wie sie sagt. Auch Hersteller müssten in diesem Zuge verstehen, was alles nötig ist, um ein Medizinprodukt auf den Markt zu bringen. Besonders um Investoren zu überzeugen. Denn hier gibt es eine ganze Menge an Kostenfaktoren zu kalkulieren.
“Die Ärzte, die Studien durchführen, müssen bezahlt werden, Datenmanagement, die Vigilanz gehören dazu, Dokumente gehören geschrieben – das alles geht nicht niedrigpreislich”, sagt Gouya-Lechner. “Während all dies und das Verständnis in der Arzneimittelbranche etabliert ist und von allen Seiten, von Politik und VCs, unterstützt wird, ist es in der Medizinproduktbranche sehr schmerzhaft. Ich habe das Gefühl, da bedarf es noch einiges an Aufklärung. Manche Hersteller (Anm. Gründer:innen) überlegen sich nicht, wie sie ein Produkt vertreiben können, wann sie einen Partner brauchen und wie viel sie investieren müssen. Sie wollen alles selber machen und ganz Europa beliefern. Aber die Frage bleibt: ‘Könnt ihr das?’ ‘Könnt ihr verkaufen?’. Diese Strategie ist nicht gut überlegt.”
Viele Faktoren zu bedenken
Gouya-Lechner wird in dieser Sache noch konkreter. Bringt man ein Medizinprodukt auf den Markt, etwa eine App, Software oder Hardware wie eine VR-Brille für Reha, so will man, dass sie jeder praktische Arzt oder Ärztin verschreibt. Das sei klar. Doch wie sieht es mit anderen Faktoren aus, die da mit dran hängen. Rückerstattungen etwa? “Dafür sind die Versicherungen zuständig und die haben Anforderungen. Wir beobachten, dass Hersteller zwar die Zulassung bekommen, dann aber nicht überleben, weil sie eben diese Frage nicht geklärt haben”, warnt sie.
Dazu gehören auch Fragestellungen, wie, wer das Produkt verschreibt, wer es verkauft oder wer es anwendet (Target Product Profile).
“Das ist der Zielpunkt, auf den du den roten Faden auffädelst”, so Gouya-Lechner weiter. “Für mich ist das einer der ersten Schritte, die Gründer machen sollten. Erst wenn ich visualisieren kann, wie das Produkt auf dem Markt ist – über den Arzt, per Onlinebestellung, handelt es sich um eine chronische Anwendung oder wird es nur im Schmerzfall genutzt – dann kann ich die Entwicklung planen. Und klären, wie die klinische Studie aussieht. Ob ich eine brauche, zwei und wie lange der Zeitrahmen dafür ist. Drei Jahre, sechs Jahre. Und wieviel Geld dafür notwendig ist.”
Zur oftmaligen Frage, wie groß die klinische Studie sein muss, gibt es keine allgemeine Antwort. Laut der Expertin gilt, wenn man es mit einem kleinen Datensatz auf den Markt schafft, dann muss die Post-Market-Vigilanz robuster aufgebaut werden. “Wenn ich dies anhand von 30 Patienten schaffe und einen 3-Millionen-Markt bestücken will, dann passt das nicht zusammen. Oder die Evidenz muss außergewöhnlich sein.”
Post-Market Sicherheit
Auf den Punkt gebracht, geht es Gouya-Lechner darum, einen konkreten Fahrplan für Gründer:innen zu erstellen, der nicht nur bis zum Markteintritt denkt, sondern auch das “danach” berücksichtigt. Daten an unterschiedliche Stakeholder zu liefern etwa. Man brauche eine ‘Post-Market-Sicherheit’.
“Ich bin überzeugt, dass man damit besser Investoren überzeugen kann”, sagt sie. “Gründer investieren zu wenig am Anfang in die strategische Planung. Da braucht es regulatorische Expertise.”
“Wie viele MedTech-Projekte wird es in ein paar Jahren geben?”
Einer, der Mitten im Feld ist, ist Thomas Huber von FemPulse. Die FemPulse GmbH wurde 2019 als MedTec-Startup in Wien gegründet und entwickelt eine patentierte, auf Neuro-Stimulation beruhende Plattformtechnologie. Das erste Produkt wird aktuell zur Behandlung der “OAB” bzw. überaktiven Blase von Frauen in EU-Europa (gem. MDR) zugelassen. In den USA strebt die minderheitlich an FemPulse beteiligte FemPulse Corp die Marktzulassung gemäß der – von der MDR komplett abweichenden – amerikanischen Regulatorik an.
Huber war von den Möglichkeiten die Neuro-Stimulation von Anfang an überzeugt und stieg daher ursprünglich mit 25 Prozent Anteilen ein, die er sukzessive auf heute 75,1 Prozent Beteiligung erhöht hat.
“Ich habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt”, sagt er, “und festgestellt, dass sich keiner auskennt. Wenn man in den Markt schaut und sieht, welche MedTech-Projekte es gibt, wundere ich mich, wie viele es davon noch in ein paar Jahren geben wird.”
Der Founder selbst kennt einige tolle Projekte und Spin-Offs mit Millionen-Investments, die aktuell eingehen. Wo ein Investor eineinhalb Jahre Kapital zugeschossen hat, aber nun meint, er lege nicht mehr nach, da man nicht fertig sei.
MDR soll “europäische Erträge für US-Firmen abdrehen”
“Im DACH-Raum sind für den MedTech-Bereich keine Investoren und keine Community vorhanden. Weil das Know-how fehlt und Beträge nun mal größer sein müssen”, sagt er und deutet ebenfalls an, was Gouya-Lechner mit fehlender Expertise feinsichtig umschreibt. Und eigentlich damit meint, es fehlt Kapitalgebern die Geduld, Erfahrung und das Wissen, was es bedeutet ein Medizinprodukt für den europäischen Markt zu entwickeln.
Die Europäische Union hat, Huber nach, mit der MDR die bisherige Verordnung (MDD) abgelöst, um zu verhindern, dass US-Firmen, wie bisher üblich, in Europa eine billige Zulassung erhalten und wieder gehen. “Es wurde mit europäischen Erträgen finanziert und das wollte man abdrehen”, sagt er.
Europa hat allgemein keine Kapitalkultur wie die USA, so die Meinung Hubers. Die Lösung der drohenden Krise könnte nur von politischer Seite kommen. Förderungen, zielgerichtete Programme für Medizintechnik aufzusetzen, und mehr Koordination.
Maßgeschneidert
“Mal macht die Stadt etwas, dann das Bundesland, die FFG und aws”, so Huber. “Das gehört besser auf den Medizintechnikbereich maßgeschneidert. So könnte man etwa Wien als Standort attraktiver machen. Spitzenforschungs-Spin-offs funktionieren oftmals nicht, weil es keiner finanziert.”
Hier seien aber nicht nur Stadt, Land, Hersteller und Kapitalgeber gefragt, sondern wie Gouya-Lechner betont: “Es muss grundlegend ein Wechsel im Gedankengut der Medizinprodukte-Industrie entstehen.”