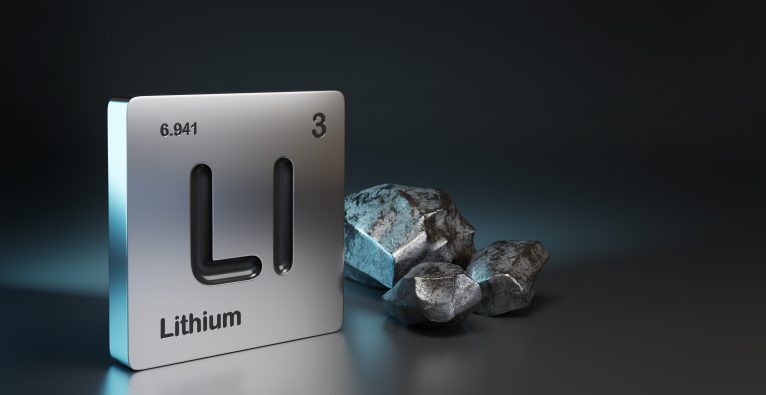✨ AI Kontextualisierung
Bis 2030 sollen mehr als 60 Prozent der weltweit verkauften Fahrzeuge E-Autos sein, schätzt die Internationale Energieagentur (IEA). Aber nicht nur für E-Autos, auch für Energiespeicher oder Handys und Laptops braucht man Lithium, auch weißes Gold genannt. Das weiß-silberne Metall wird in Lithium-Ionen Batterien benötigt, welche als eine der besten Optionen für das Halten der Ladung und die effiziente Stromabgabe gesehen werden.
Von der EU wird der Rohstoff als kritisch kategorisiert, weil Lithium für die Industrie sehr wichtig ist und die Gefahr von einem Versorgungsrisiko bestehen kann. Selten ist Lithium auf der Erde nicht, aber “Lithium ist in Gesteinen selten so stark konzentriert, dass es sich für den Bergbau rentieren würde”, erklärt Frank Melcher von der Montanuniversität Leoben.
Vor allem Australien, Chile und China beliefern die Welt mit Lithium. Gestörte Lieferketten haben die heimische Industrie schon häufiger vor Herausforderungen gestellt. Welche Möglichkeiten hat also die EU, sich unabhängiger von Lithium-Importen zu machen? Brutkasten hat bei vier Wissenschafter:innen nachgefragt – hier ist ein möglicher Fahrplan aus der Lithium-Abhängigkeit.
Ein Blick in den Rückspiegel
“Noch vor 20 Jahren ist Lithium ein Rohstoff mit relativ geringer Bedeutung gewesen”, sagt Melcher. Doch mit dem Aufkommen der Lithium-Ionen-Batterien und der Zunahme von Elektroautos, hat Lithium einen hohen Stellenwert eingenommen.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten das weiße Gold abzubauen: Zum einen findet sich Lithium in Festgesteinen, zum Beispiel in Australien. Die zweite Möglichkeit ist Lithium aus Salzseen zu gewinnen. Diese findet man beispielsweise im sogenannten Lithium-Dreieck in Chile, Argentinien und Bolivien. In den ohnehin trockenen Gegenden sorgt der Abbau des weißen Goldes für Grundwassermangel, da es zahlreiche Verdunstungsschritte braucht, um Lithium verfügbar zu machen.
Die Internationale Energieagentur schätzt, dass die Welt bis 2040 rund 40 mal mehr Lithium braucht, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Außerdem erwartet sie, dass Hersteller bis 2030 nur die Hälfte des Bedarfs der Lithium-Industrie decken und gleichzeitig die Klimaziele erreichen können. Für die Herstellung von einer Tonne Lithium würden zwischen drei und 17 Tonnen Kohlendioxid verbraucht. Das sei bis zu elf mal so viel, wie für die Herstellung von einer Tonne Stahl ausgestoßen wird. 70 Prozent dieser Emissionen fallen bei der Verarbeitung von Lithium an.
Station 1: Reserven in Europa nutzen
Die Reise beginnt in Wolfsberg in Kärnten. Dort soll sich eines der größten Lithium-Vorkommen in Europa befinden. Die Rechte für den Abbau wurden 2011 an das australische Unternehmen European Lithium verkauft, das dort auch Lithium gewinnen will, wie der Standard berichtete.
In Europa selbst mehr Lithium abzubauen, wäre durchaus möglich. Von der Entdeckung bis zur Produktion von Lithium vergehen im Durchschnitt aber rund 16 Jahre. Wir wissen aber schon heute, dass es Lithium-Vorkommen in Europa gibt. Beispielsweise in Serbien oder Portugal, doch Bürgerproteste verhindern dort den Fortschritt der Projekte.
In einer Analyse der Fachzeitschrift Nature schreiben Expert:innen: “Langfristig ist die Inbetriebnahme weiterer Minen und Verarbeitungsanlagen der einfachste Weg, die Energiesicherheit zu gewährleisten.” Auch Melcher sieht in der Nutzung der europäischen Lithiumreserven großes Potential. So könne man mit drei oder vier Lithium-Projekten in Europa relativ schnell bis zu 30 Prozent der Weltproduktion erreichen.
“Es ist meiner Meinung nach absolut sinnvoll, wenn wir auf Elektromobilität setzen – und das ist offensichtlich der politische Wille, dass man diese Batterien auch in Europa baut. Denn wir machen uns sowieso bei sehr vielen Bauteilen stark abhängig vom Import, vor allem von China”, erklärt Melcher.
Station 2: Abfall besser nutzen
Mehr Lithiumabbau in Europa ist also ein möglicher Weg, aber das alleine dürfte für die Unabhängigkeit noch nicht reichen: “Wenn man den prognostizierten Bedarf auf die Ziele hochrechnet, werden wir bis 2050 insgesamt etwa 15 mal mehr Lithium abbauen müssen als bisher in den vergangenen 40 Jahren gewonnen wurden”, rechnet Melcher vor.
Der Abfall sei auf jeden Fall auch ein Problem, das mit Lithium einhergehe und werfe die Frage auf: Was machen wir mit den Abfällen? Laut Melcher geht mit einem Prozent Lithium im Erz 99 Prozent Reststoffe einher. “Die Strategie im Bergbau ist, aus allem ein Produkt zu machen. Das bedeutet, dass man diese Reststoffe soweit aufbereitet, um sie wieder verkaufen zu können, denn Deponien sind in Europa schwer vorstellbar”, so Melcher.
In der Lithium-Ionen-Industrie könnten laut Nature Experten außerdem im Jahr 2030 fast acht Millionen Tonnen Natriumsulfat als Abfall produziert werden. Noch werde der Abfall entweder auf Deponien gelagert oder nach Übersee verschifft. Dieses Natriumsulfat könne man aber wieder aufbereiten und für die Lithium-Ionen Batterieherstellung nutzen. “Das ist aber alles noch Zukunftsmusik, aber technisch möglich wäre vieles”, erklärt Florian Part von der Universität für Bodenkultur Wien.
Station 3: Repurposing und das zweite Leben
Auch Part sieht in der effizienteren Nutzung von Abfall einen Teil des Weges in die Unabhängigkeit. Eine Grundsatzregel sei: “Je länger die Stoffe bzw. Produkte im Umlauf sind, desto besser für die Umwelt”, so Part. Er beschäftigt sich unter anderem damit, wie man Lithium-Ionen-Batterien ein zweites Leben einhauchen kann. Hersteller sprechen momentan von einer Lebensdauer der Batterien von sieben bis zehn Jahren.
Aufgrund von Gewährleistungsverpflichtungen der Automobilhersteller müssen Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos bei einer Restkapazität von derzeit 70 Prozent ausgetauscht werden. Der Grund dafür sei, dass diese nicht mehr die gewünschte Leistung erbringen. “Da ist die Idee, dass man diese Batterien durch ein Repurposing länger im Umlauf halten kann. Zum Beispiel kann man diese für Second-Life-Batteriespeicher nutzen”, erklärt Part.
Die Lithium-Ionen-Batterien aus Autos werden also wiederverwendet. Teilweise würde das auch schon im größeren Maßstab umgesetzt werden, hauptsächlich befinde man sich aber im Pilotmaßstab. “Es gibt da beispielsweise einen Second-Life-Speicher von Saubermacher in der Steiermark. Die großindustrielle Umsetzung scheitert derzeit aber an diversen Marktmechanismen”, so Part.
Dabei gehe es vor allem um die Frage: Sind Second-Life Speicher profitabel? “Derzeit ist die klare Antwort: Nein. Das kann sich auch ändern. Meiner Meinung nach müsste man den Einsatz mit Subventionen oder auch strengen Vorgaben der EU forcieren”, meint Part. Der freie Markt könne dieses Problem nicht regeln, da Second-Life-Batterien mit billigen Neubatterien aus China konkurrieren müssen. “Bei der Importabhängigkeit von Lithium kann Repurposing einen Beitrag leisten, weil man das Problem etwas hinauszögert. Erst nach dem Repurposing gehen die Stoffe in das Recycling”, so Part.
Station 4: Recycling von Lithium-Ionen-Akkus
Auf der Reise in die Unabhängigkeit von Lithium-Importen könnten schon bald zahlreiche Elektroautos in den Ruhestand gehen. Doch was macht man dann mit all den Lithium-Ionen-Batterien? Eine Möglichkeit ist, Inhaltsstoffe wie Lithium zu recyceln.
“Elektromobilität ist auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag zur Klimawende, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Es kann aber natürlich nur dann funktionieren, wenn wir einen geschlossenen Recyclingkreislauf haben”, erklärt Eva Gerold von der Montanuniversität Leoben. Die Technologien dafür gäbe es schon, in Bezug auf den großflächigen Einsatz, handle sich im Moment aber vor allem um eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
Laut Gerold wird sich aber nicht die Frage stellen, ob recycelt werden soll oder nicht. Die neue Battery Directive der EU, die kommen wird, mache klare Vorgaben: “Diese Richtlinie wird vorgeben, dass man bis 2030 90 Prozent des Nickels und Kobalts und 70 Prozent des Lithiums aus einer verbrauchten Lithium-Ionen-Batterie zurückgewinnen muss”, so Gerold.
Wichtig sei, die Forschung konstant zu fördern, um am Ball zu bleiben. “Ich glaube, es passiert natürlich schon viel in Bezug auf die Förderung der Forschung, aber es passiert noch zu wenig, um Europa strategisch abzusichern”, so Gerold. Für die Unabhängigkeit von Lithium-Importen könne man mit Recycling eine gewisse strategische Unabhängigkeit erreichen. “Da dies zumindest einen Teil der Lithium-Abhängigkeit abändern kann. Der gesamte Bedarf an Lithium lässt sich allerdings nie durch Recycling abdecken, da der Bedarf weiter steigt”, so Gerold.
Station 5: Die Suche nach Alternativen
Am Ende des Weges aus der Abhängigkeit stellt sich auch die Frage nach Alternativen. Forscher der TU Wien haben beispielsweise eine Sauerstoff-Ionen-Batterie erfunden. Diese soll extrem langlebig sein, ohne seltene Erden auskommen und das Problem der Brandgefahr lösen. Statt Lithium wird Keramik verwendet und wo andere Batterietypen an Kapazität verlieren, könne sich die Sauerstoff-Ionen-Batterie selbst regenerieren.
Für Elektroautos oder Smartphones sei das Batteriekonzept nicht gedacht. “Es gibt bestimmte Bereiche, für die es nicht absehbar ist, Lithium-Batterien leicht ersetzen zu können. Dafür gibt es andere Bereiche, wo es geht und wo der Einsatz von Lithium-Batterien Verschwendung wäre”, sagt Alexander Schmid von der Technischen Universität Wien.
Für große Energiespeicher könne die Sauerstoff-Ionen Batterie eine gute Lösung sein. “Wenn wir in absehbarer Zeit weg von fossiler, teilweise weg von Kernenergie und hin zu Solar- und Windenergie gehen, braucht es sehr große Speicher”, so Schmid. Die Batterie-Idee wurde bereits als Patent angemeldet.