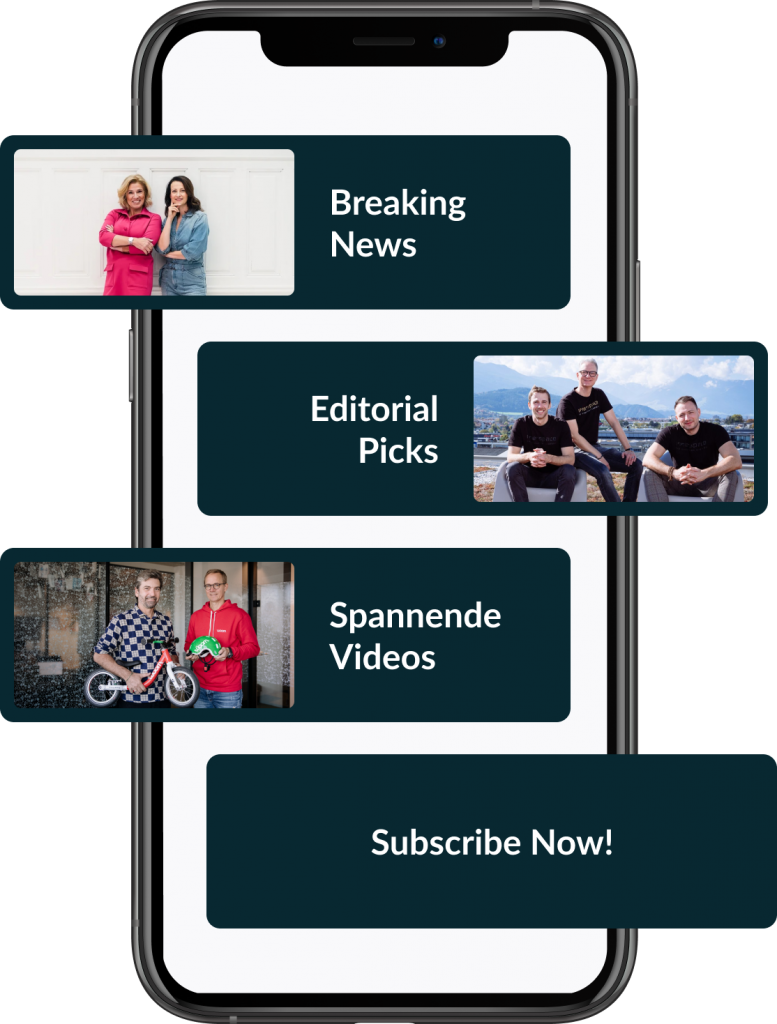✨ AI Kontextualisierung
Wie innovativ ist die Finanzbranche? fragte der SPÖ-Parlamentsklub bei seiner Enquete zum Thema „FinTechs unter der Lupe“. Innovation macht vor nichts halt, weder vor der Architektur des Parlaments – es ist eine der letzten Veranstaltungen hier vor der dreijährigen Umbauphase – noch vor der Finanzbranche, die „in die Jahre gekommen“ sei, vergleicht Klubobmann Andreas Schieder.
Die Abgeordnete zum Nationalrat, Elisabeth Hackel, kuratierte die Enquete entlang der Fragen: Warum sind gewisse FinTechs nach Deutschland gegangen? Wie kann man den FinTech-Markt in Österreich ankurbeln? Können Banken und FinTechs voneinander lernen?
„Wir sind keine Bankenkonkurrenz“
Die Bankendichte ist im EU-Vergleich in Österreich besonders hoch. Von der anderen Seite kommt die Financial Technology. Als Vertreter dafür sind Lorenz Jüngling von N26 und Daniel Striedner, Cashpresso-CEO, am Panel. „Wir sind keine Bankenkonkurrenz, sondern versuchen, sie an der Hand zu nehmen. Ohne Banken könnten wir ja nicht arbeiten. Wir haben keine Lizenz, um unseren Kredit zu vergeben“, meint er. Dennoch: FinTechs hätten die besseren IT-Systeme und könnten Entscheidungen schneller treffen. Dem würde hier wohl kaum jemand widersprechen. Ohne das entsprechende Biotop könnten die neuen Player am Finanzsektor aber nicht existieren. Gerade das sei ihr Vorteil, meint Sebastian Erich, Mitglied des Vorstands bei AVCO, Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation. „Deswegen hat es keinen Sinn sie aufzukaufen, aber sie bewegen den Markt.“ Gleichzeitig hoffen die Banken, dass der Regulator lockert, „weil wenn du deinen regulierten Banken immer mehr Prügel in den Weg legst, wird der Markt tot sein. Dann wird es die Banken – FinTechs hin oder her – nicht mehr geben.“
Das richtige steuerliche Umfeld für Startups
Ohne dem richtigen Steuerumfeld werden sich FinTechs – genauso wie Startups in allen Branchen – verabschieden aus Österreich, meint Erich. „Sie finden das Kapital nicht. Das ist in fast allen anderen europäischen Ländern besser“, sagt er. „Der Kapitalmangel muss politisch schnell angegriffen werden“. Das Biotop müsse vorbereiten werden. Dann könne man im Besten Fall auch vom sich auflösenden Zentrum in London (Die Brexit-Verhandlungen haben gestern begonnen) profitieren.
Von dort eingeflogen ist Matthias Bauer von der Financial Contact Authority, einer Art Finanzmarktaufsicht. Dort versucht er im Innovation Hub Herangehensweisen zu ändern. Innovative Firmen kommen zur Beratung, hauptsächlich geht es um Konzessionsrechtliches. Seit Ende 2014 gibt es die „Regulatory Sandbox“. Sie ermöglicht es Unternehmen, innovative Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und Liefermechanismen auf dem realen Markt mit echten Verbrauchern zu testen. Das Ganze geschieht aber in geschütztem Rahmen. „Das ist keine Deregulierung, sondern Testen unter strenger Aufsicht“, erklärt Bauer. Bisher gab es circa 700 Anfragen. Der FCA nutzt es: Sie lernt innovative Geschäftsmodelle kennen und kann schon im Aufbauprozess versuchen, Services für den Konsumenten sicher zu machen.
FinTechs haben die Softwareentwickler, die Banken haben die Kunden
Mit der Sandkiste auch etablierte Banken angesprochen. Und auch aus dieser Ecke sitzt natürlich jemand mit in der Diskussion. Peter Bosek von der Erste Bank prognostiziert in seiner Keynote, dass viele FinTechs die zweite und dritte Runde nicht überleben werden, weil sie davon ausgehen, dass die Kundenakquisition nix kostet. Nichtsdestotrotz gebe es einige gute und sie hätten hervorragende Softwareentwickler – das sei eher ein blinder Fleck bei den traditionellen Bankhäusern.
Innovationen sind in großen etablierten Unternehmen oft eine zarte Pflanze, die Gefahr läuft, schnell zertrampelt zu werden. Deswegen entstand das Online-Banking George in einem Extra-Hub. Und „dort sind wir komplett offen für die Kooperation mit FinTechs“, meint Bosek. Während die Bank 16 Millionen Kunden mitbringt, können FinTechs mit innovativen Softwarelösungen punkten. Beteiligen würde er sich als Bank nicht an Startups, weil er sie einerseits für überbewertet hält und andererseits zu viel Nähe eines großen Unternehmens das Startup erdrücken würde. Bosek spricht von unterschiedlichen Schrittgeschwindigkeiten und ist für Kooperation auf Augenhöhe.
Als Bank auftreten, aber das Startup-Umfeld behalten
N26, dessen COO Lorenz Jüngling als nächster spricht, hält er für eines der wenigen erstzunehmenden FinTechs. Gegründet 2013 von zwei Wienern in Österreich, ist das Unternehmen nach Berlin gewechselt und hat mittlerweile eine eigene Banklizenz. Es gäbe mittlerweile 220 Mitarbeiter, aber „keine Filialen und kein IT-System, das 30 Jahre alt ist und auf Relaunch wartet“.
Redaktionstipps
Die Organisationsform sei die eines Technologieunternehmens. „Gleichzeitig treten wir auf der Seite des Regulators als Bank auf, aber unser Umfeld bleibt dynamisch und flexibel, um wie ein Startup zu funktionieren“. Es beschränkt sich auf B2C und setzt den Fokus auf allem, was online und am Handy möglich ist. Jüngling geht es nicht um klassische Anlageprodukte. N26 vermittelt zwischen User und der Finanzdienstleistung, sieht die Transaktionssysteme der Leute und ihre Versicherungsdaten und kann sie auswerten: Was sind die Bedürfnisse des Users? Wie kann man daraus einen Wert generieren, der sich monetarisieren lässt?
Bosek ist das zu intransparent: „Eure Kooperationspartner check ich gar nicht“, sagt er. Das bringe die Kohle von großen Banken zu solchen, die keine Regeln haben.
Kritik an der Finanzmarktaufsicht
Mit konkreter Erfahrung meldet sich auch ein Teilnehmer zu Wort. Er betont den Austausch bevor es zum Regulator geht. Als er 2012 selbst zur Finanzmarktaufsicht (FMA) gegangen ist, hat er gemerkt, dass es nicht gewollt war, dass er die Zahlungslizenz bekommt. Er schätzt den Ansatz der Londoner FCA, die sich fragt: Was braucht der Kunde? und über den Ombudsmann rasch reagiert. In seinem FinTech-Unternehmen hätten die Anwälte viel abgefangen. Es geht nicht im Vorhinein zu entwickeln, was der Kunde vielleicht möchte, sondern um den flexiblen Austausch im Frühstadium. Das würde mehr helfen.
Europa punktet mit Rechtssicherheit
In punkto Rechtssicherheit hätte Europa übrigens einen Vorsprung, meint Matthias Bauer. Es sei sehr viel einfacher, verglichen mit den USA, wo man 50 verschiedene Lizenzen braucht. Da stimmt ihm der Cashpresso-Gründer Striedner zu: „Man kann darüber diskutieren, ob etwas zu viel reguliert ist, aber zumindest ist es rechtssicher.“ Das Startup möchte bewusst in Österreich verwurzelt bleiben. Er lobt die Webentwickler aus Universitäten und Fachhochschulen, sieht aber, dass die FinTech-Nische sehr kapitalintensiv ist, im Vergleich zu anderen Startups. Und das liegt gerade an der rechtlichen Beratung und den Custumer Acquisition Costs. Die Baustellen sind also schon einmal klar absteckt nach dieser Enquete.