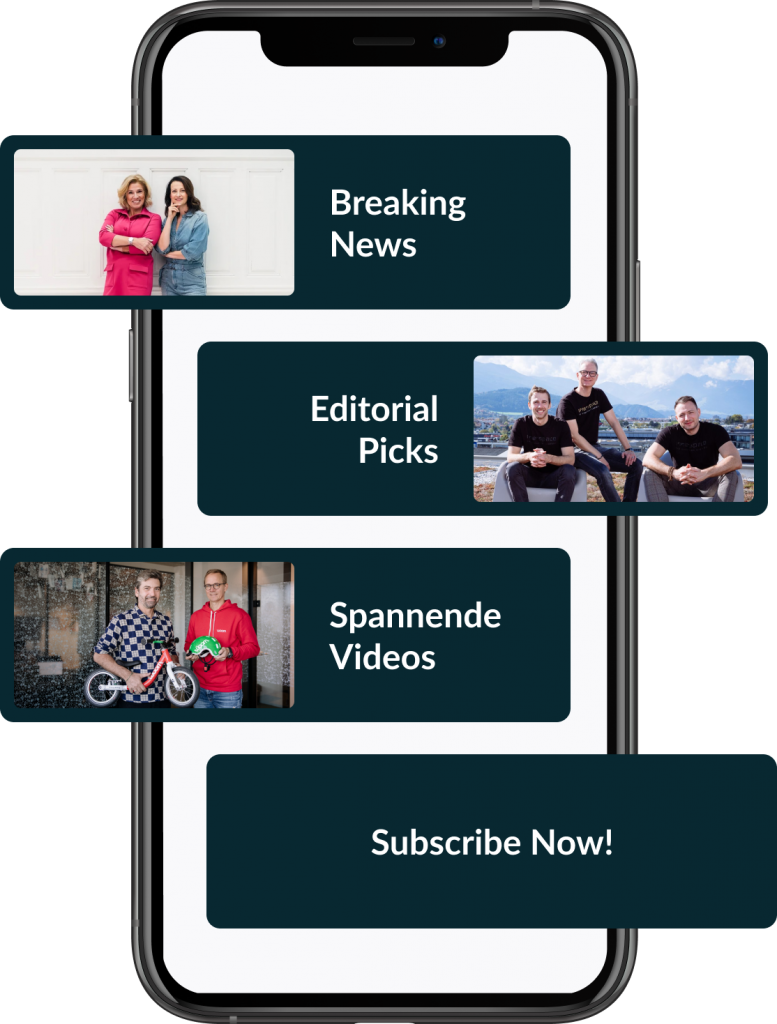✨ AI Kontextualisierung
In den Erkenntnissen der Studie zeigt sich, dass “Gefährder” immer öfter technische Mittel zur Gewaltausübung anwenden. Für die Gefahr von Cyber-Gewalt gelte es, Bewusstsein und Wissen zu schaffen – sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf behördlicher Ebene. Dieser Apell stammt u.a. von Magdalena Habringer, Projektleiterin der Studie sowie Forscherin und Lehrende an der FH Campus Wien.
Cyber-Gewalt: Datenproblem und Abhängigkeiten
“Wenn der Gefährder der eigene Partner ist oder war, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er die Passwörter der Betroffenen kennt und damit Zugriff auf Geräte, Daten und Accounts hat, die eine fremde Person nicht so einfach hätte. Außerdem bestehen oft Abhängigkeiten oder es gibt gemeinsame Kinder, die eine Trennung oder die Hilfesuche erschweren”, erklärt sie.
Hinzu komme die gesellschaftliche Verharmlosung von digitalen Übergriffen: “Vor allem anfangs wird Cyber-Gewalt nur schwer als solche erkannt. So waren einige Befragte und ihr soziales Umfeld am Beginn der kontrollierenden Cyber-Gewalt noch überzeugt, dass die ständige Frage ‘Wo bist du, was machst du?’ ein Ausdruck von Liebe sei“, so Habringer weiter.
Nacktbilder und Demütigung
Digitale Übergriffe können unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Die Studie verdeutlicht, dass Cyber-Gewalt meist sexualisiert ausgeübt wird. Häufig werden Nacktbilder veröffentlicht oder es findet eine sexualisierte Demütigung in den sozialen Medien statt – teils auch unter Manipulation des sozialen Umfeldes der Frauen.
Personen im Umfeld wurden zudem teilweise zu Mittäter:innen, etwa wenn Freunde oder Freundinnen der Betroffenen begannen, sie aufgrund jener Nacktbilder zu beschimpfen, die der Gefährder veröffentlicht hat.
“Für von Cyber-Gewalt betroffene Frauen ist es schwer, einen sicheren Rückzugsort zu finden, ohne etwa auf das Smartphone oder die sozialen Medien gänzlich zu verzichten. Das ist ein wesentliches Charakteristikum von Cyber-Gewalt”, betont die Forscherin.
Schwierige Beweissicherung bei Cyber-Gewalt
Um den technologischen Entwicklungen begegnen und Cyber-Gewalt entsprechend ahnden zu können, wären sowohl zusätzlicher IT-Support als auch verstärkte personelle Ressourcen bei Institutionen wie Staatsanwaltschaften und Polizei notwendig.
Nina Wallner, Sozialarbeiterin im Gewaltschutzzentrum Burgenland, die die Studie unterstützt hat, weiß aufgrund ihrer Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz: “Die Beweissicherung bei Cyber-Gewalt ist herausfordernd und zeitaufwändig. Digitale Übergriffe sind mitunter schwer fassbar und vielschichtig. Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, benötigt es Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen.”, sagt sie.
Besonders wichtig seien hierbei einerseits die Vernetzung zwischen den zuständigen Institutionen, um einen gemeinsamen Umgang mit der Cyber-Gewalt im Beziehungskontext zu finden und andererseits der gesellschaftliche Diskurs, um Bewusstsein für das Thema zu schaffen.
Ohnmacht eine Folge von gesellschaftlicher Verharmlosung
“Eine zentrale Auswirkung von Cyber-Gewalt ist Ohnmacht. Diese ist unter anderem auf gesellschaftliche Verharmlosungen und ein teilweise noch wenig sensibilisiertes Hilfesystem zurückzuführen”, so Habringer an dieser Stelle.
„Manchmal sprechen Betroffene in der Beratung lediglich Vermutungen oder diffuse Wahrnehmungen über das Erlebte aus. Die Strategie vieler Gefährder liegt genau darin, die Wahrnehmung der Betroffenen zu manipulieren“ weiß Wallner. „In der Beratung nehmen wir dieses Gefühl der Bedrohung ernst, denn dies ermöglicht erst, Hinweise auf Cyber-Gewalt zu erkennen und sie somit sichtbar zu machen“, so Wallner.
Betroffene können das Beratungsangebot der Gewaltschutzzentren nutzen, um den Kreislauf von Angst und Hilflosigkeit zu durchbrechen. Der Bundesverband der Gewaltschutzzentren ist unter 0800 700 217 erreichbar.