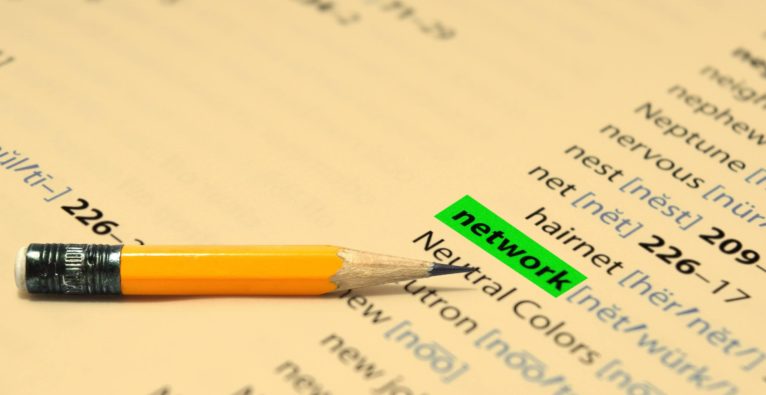✨ AI Kontextualisierung
Teil drei des Brutkasten-Startup-Glossars: Diesmal beleuchten wir, wie man mit dem richtigen Keyword laut Long-Tail-Theorie sein Minimal Viable Product absetzen kann, vor allem wenn man ein Nerd ist und sich online gut auskennt. Oder so…
A – E | F – J | K – O | P – T | U – Z
K
Keyword
Wer mit seiner Website bei Suchmaschinen ganz oben stehen will, braucht das richtige Keyword beziehungsweise die richtige Kombination von Keywords. Die Wörter sollten möglichst prägnant beschreiben, was man macht oder produziert und zugleich möglichst einzigartig sein. „App“ und „Startup“ sind demnach keine optimale Auswahl – unter den rund 90 Millionen Treffern auf Google, könnte das eigene Startup schwer zu finden sein. Besser ist da schon das Keyword „smarter Klopapierhalter“. Mit dem hat es übrigens tatsächlich jemand auf Kickstarter versucht, erreichte mit 210 Unterstützern aber nur etwa ein Drittel des Finanzierungsziels.
Kickstarter
Inzwischen gibt es einige Formen des Crowdfundings. Kickstarter ist eine der beliebtesten davon. Das Prinzip ist einfach: Man verkauft sein Produkt, bevor man es überhaupt produziert hat – teilweise sogar, bevor man überhaupt genau weiß, wie und wo man es produzieren wird. Der Vorteil für Startups: Sie geben dabei keine Anteile ab, sondern müssen lediglich das Produkt liefern, wenn es dann endlich fertig ist (und sollten sich dabei an die eigenen Ansagen halten). Der Vorteil für Kunden: Sie müssen keine Anteile kaufen. Sie können also ein Startup unterstützen und haben sogar dann etwas davon, wenn das Businessmodell den Markt doch nicht so disruptet, wie versprochen. ⇒ Das wurde bei erfolgreichen Kickstarter-Kampagnen richtig gemacht
L
Launch
Der große Moment. Es ist soweit. Das Produkt/ die App ist erhältlich, der Dienst wird jetzt angeboten, das Ding ist online! In der Startup-Welt beginnt, startet oder veröffentlicht man nicht, man launcht. Weil Rockets werden schließlich auch gelauncht. Und das Ding soll performen wie 1 Rocket.
Lean Management
Auf Deutsch: „Schlankes Management“. Der Begriff bezieht sich jedoch nicht auf den Körperumfang der Manager in einem Startup oder Unternehmen. Stattdessen geht es um Prozessoptimierung und flache Hierarchien. Startups haben da, vor allem in der Anfangsphase, meist leichtes Spiel. Denn solange die Firma nur aus einem CEO, einem CTO und einem CFO besteht, drohen noch keine überflüssigen Management-Ebenen die Arbeit zu verkomplizieren. Mit dem Wachstum kommt dann natürlich manchmal die Idee auf, guten Freunden einen Job als Abteilungsleiter zu geben. Davon ist nicht nur nach der Lean-Management-Theorie abzuraten.
Lean Startup
Der Lean-Startup-Theorie (zu Deutsch: „Schlankes Startup-Theorie), die 2008 von US-Entrepreneur Eric Ries vorgestellt wurde, liegt ein einfacher Gedanke zugrunde: Mit möglichst geringem Kapitalaufwand möglichst erfolgreich sein. Allen, die sich nun fragen, was auf der Welt ein Startup, oder ein Unternehmen im allgemeinen, denn bitte sonst zum Ziel haben sollte, sei gesagt, dass das noch nicht die ganze Theorie ist. Konkret ist die Idee, möglichst schnell mit einem sogenannten Minimal Viable Product (MVP), also einem funktionstüchtigen Prototypen, oder einer Beta-Version, auf den Markt zu gehen. Dieses MVP soll dann durch stetiges Kundenfeedback solange adaptiert werden, bis es wirklich passt. Dabei soll es aber schon die ganze Zeit Umsätze bringen. Easy, oder? „Viable“ bedeutet übrigens überlebensfähig. Wenn man seine App frühzeitig launcht, der Server dann aber bei 150 Usern w.o. gibt, ist sich nicht viable – nur so als Tipp.
Long Tail-Theorie
Startups müssen den Begriff nicht kennen, um die Theorie anzuwenden. Sie besagt, dass man Dank des Internets in Nischenmärkten sehr erfolgreich werden kann. Denn die weltweite Nachfrage kann auch in einer kleinen Nische insgesamt recht groß werden. Voraussetzung ist, das man tatsächlich jene Nische findet, in der es noch kein Produkt gibt. Und das ist noch keine Erfolgsgarantie: Der smarte Klopapierhalter hat es trotzdem nicht geschafft.
M
Markt
Das sollte jedes Startup haben. Wirtschafts-umgangssprachlich kann man Markt mit Nachfrage gleichsetzen (obwohl natürlich per Definitionem ein Markt erst entsteht, wenn Nachfrage und Angebot aufeinander treffen). Viele Startups scheitern jedenfalls daran, dass es für ihr Produkt keinen, oder einen zu kleinen Markt gibt. Bietet man etwa eine ortsgebundene Dienstleistung an, ist für die Kalkulationen die lokale und nicht die globale Nachfrage heranzuziehen. Bietet man sein Produkt, zum Beispiel einen smarten Klopapierhalter, global an, reicht es nicht, wenn weltweit 210 Personen das Ding haben wollen, obwohl sogar TechCrunch über einen geschrieben hat.
Millionenbetrag
Eine sieben bis neunstellige Zahl. In Österreich weitgehend ein Fremdwort, wenn es um Investments in Startups geht. Andernorts, vor allem im Silicon Valley sind Beteiligungen in der Höhe hingegen durchaus üblich. Dort sind jedoch auch Arbeitskräfte, Mieten und überhaupt alles meist deutlich teurer. Wirklich schön soll es dort auch nicht sein, hört man.
Minimal Viable Product (MVP)
Siehe Lean Startup. Da oben bereits umrissen wurde, was ein MVP ist, hier noch ein paar Beispiele, was kein MVP ist, nur um sicherzugehen: Eine App, die aufgrund diverser Bugs ständig abstürzt; ein Programm, von dem einstweilen nur die Nebenfunktionen laufen, nicht aber die Hauptfunktion; ein explodierendes Smartphone (zugegeben, das kam nicht von einem Startup); halt alles, was einfach noch nicht funktioniert – ist ja nicht so schwer, sollte man meinen. Aber es gibt doch einige Beispiele, wo Startups mit einem nicht-MVP auf den Markt gegangen sind. Wir nennen keine Namen.
N
Nerd
Vor allem unter Tech-Startup-Foundern gibt es eine sehr hohe Dichte davon. Als Nerd werden heute besonders Technik-affine Menschen bezeichnet. In manchen Bereichen genießt man überhaupt keine Glaubwürdigkeit mehr, wenn man kein Nerd ist. Ursprünglich hatte das Wort mit „Schwachkopf“ oder „Trottel“ eine ganz andere Bedeutung. Der Bedeutungswandel hat sich noch nicht überall herumgesprochen: Denn die heute erfolgreichen Nerds wurden vielfach in der Schule von Menschen als „Trottel“ bezeichnet und gemobbt, die nun dafür nur ein Hundertstel ihres Gehalts verdienen. Das ist wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Erstmals nachgewiesen ist es das Wort übrigens in einem Dr. Seuss-Kinderbuch von 1950.
Networken
Darum geht es in der Business-Welt. Networken, networken, networken. Bei jedem Startup-Event und bei überhaupt jeder Gelegenheit muss man neue wichtige Leute kennenlernen, seine Idee pitchen und mögliche Kooperationen besprechen. Die Devise lautet: Ein größeres Netzwerk macht alles besser. Einfach mal allen das Blaue vom Himmel versprechen und dann erst sehen, ob man es tatsächlich umsetzen kann. So gewinnt man Kunden und Partner – wenn man es dann halt wirklich schafft, die Dinge irgendwie umzusetzen. Und natürlich kann man dann immer behaupten, dass man alle kennt – das ist überhaupt sehr wichtig, denn es macht einen selbst sehr wichtig.
O
online
Online ist in der Startup-Welt ohnehin alles. Und doch ist das Internet, so selbstverständlich es auch ist, extrem wichtig für das Prinzip Startup an sich. Daran kann kein Zweifel bestehen und deswegen bekommt es hier im Startup-Glossar seinen Platz. Viele Startups sind schon mit genuinen Online-Services groß geworden. Das Geschäftsmodell sehr vieler weiterer Startups besteht daraus, etwas herzunehmen, was es schon sehr lange gibt, es nun aber online anzubieten. Auf diese weise sind in den letzten Jahren unzählige mehr oder weniger erfolgreiche Online-Shops, Online-Plattformen, Online-Beratungsstellen und dergleichen entstanden, die uns ersparen, unsere Wohnungen zu verlassen.
Org Design
Bei Org Design geht es um die Frage, wie die Firma strukturiert und organisiert sein soll. Tatsächlich ist das ein wichtiger Punkt, vorausgesetzt die Firma besteht bereits aus mehr als den drei Personen, aus denen die meisten Startups in der Anfangsphase bestehen. Natürlich kann man aber auch schon zu dritt ein Organigramm erstellen. Oder auch alleine – das ist dann besonders übersichtlich.