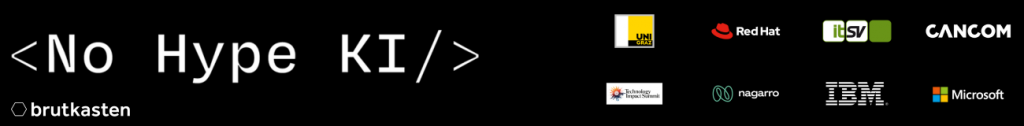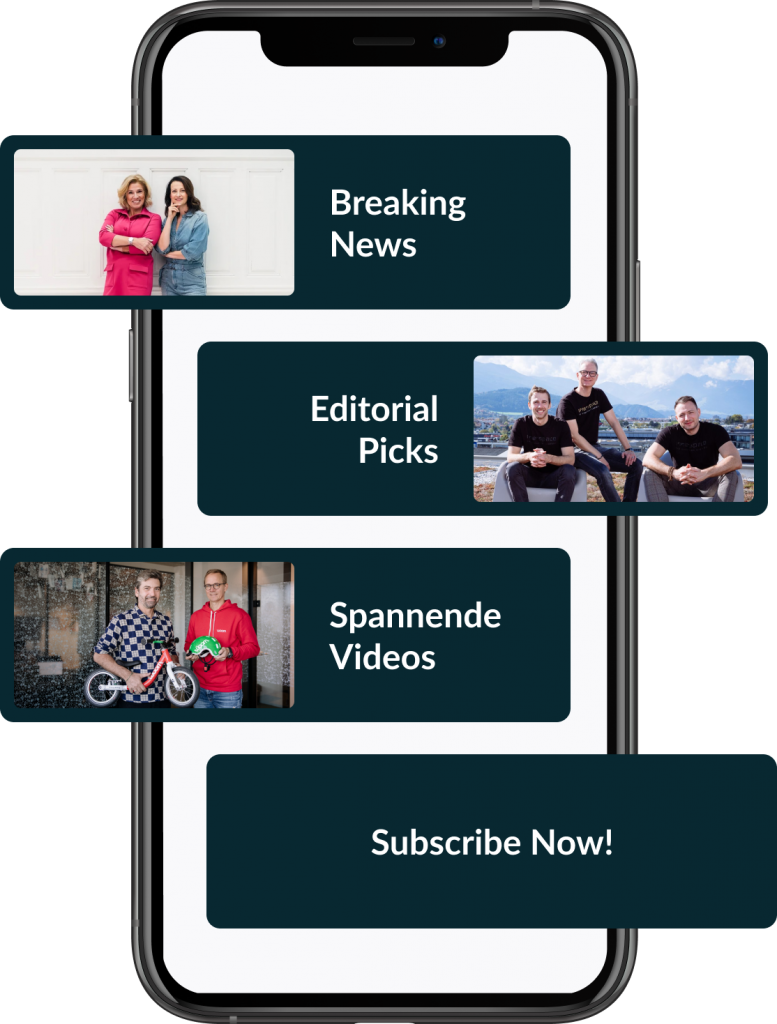✨ AI Kontextualisierung
Tanja Emmerling ist seit über einem Jahrzehnt erfolgreich als Investment-Managerin im Digital-Tech-Sektor aktiv. Mit einem Portfolio von 14 Unternehmen und der Begleitung von rund 30 Beteiligungen als Projektleiterin hat sie sich als Expertin im Bereich der Startup-Finanzierungen etabliert. 2018 übernahm sie eigenverantwortlich den Aufbau des Berliner Standorts des High-Tech Gründerfonds und leitet seither die Dependance in Berlin.
Der High-Tech Gründerfonds wurde 2005 ins Leben gerufen, um den damals stagnierenden Markt für Gründungsfinanzierungen neu zu beleben. Sein Fokus liegt bis heute auf Tech-Startups mit hohem Wachstumspotenzial, wobei Investitionsentscheidungen – wie es seitens des Fonds heißt – „nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien“ getroffen werden.
Im Gespräch mit brutkasten gibt Emmerling einen Einblick in die Welt der Deep-Tech-Investitionen und die Strategie des Fonds. Zudem spricht sie über die Herausforderungen europäischer Startups beim Börsengang und notwendige Änderungen auf europäischer Ebene, um im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben.
brutkasten: In welchen Bereichen investiert der High-Tech Gründerfonds? Gibt es am Markt aktuell gewisse Trends oder spezifische Nischen, wo ihr einen Fokus legt?
Tanja Emmerling: Der High-Tech Gründerfonds ist als der aktivste Seed-Investor in Europa einzuordnen. Wir haben aktuell zwei Milliarden Euro unter Management, befinden uns in der vierten Fonds-Generation, verfügen über 500 Millionen im laufenden Fonds und haben zusätzlich einen Wachstumsfonds für unser eigenes Portfolio, um auch die großen Tickets im later Stage stemmen zu können.
Das ist deshalb entscheidend, weil gerade die Deep-Tech-Bereiche sehr kapitalintensiv sind, wenn die wirklich spannenden Unternehmen später entsprechend große Investments benötigen, um in die Wachstumsgrößen zu gelangen. Da in Europa und auch in Deutschland nach wie vor ein Mangel an solchen Finanzierungen besteht, können wir bei einer top Performance hier gut unterstützen.
Dabei haben wir einen Technologiefokus, der die komplette Bandbreite abdeckt: Wir beschäftigen uns mit Life Sciences, inklusive Drug Development, Digital Tech, wo auch die digitalen SaaS-Plattformen einzuordnen sind, und einem Sektor, den wir als Industrial Tech bezeichnen. Industrial Tech umfasst Bereiche mit einem gewissen Hardware-Software-Bezug, die produktionslastig sind, aber auch Themen wie Mobility, Energiemanagement, Circular Economy, Agritech, Halbleiter, Aviation, New Space, Quantum Computing und in Teilen auch Artificial Intelligence – jeweils soweit diese in Produktionsprozesse eingebunden werden.
Gerade in Deutschland ist dieser Bereich von großer Bedeutung, da unsere Wirtschaft vom Mittelstand lebt – den Hidden Champions, die stark produktionslastig und exportgetrieben sind, sich im Umbruch befinden, sich selbst erneuern, neue Innovationen finden und teilweise auch einen Generationswechsel durchlaufen.
2021 boomten Startup-Finanzierungen. 2022 kühlte der Markt wegen des Ukraine-Kriegs, steigender Zinsen und anderer Faktoren ab. Wie hat sich das auf eure Investment-Strategie ausgewirkt?
Tanja Emmerling: Überraschenderweise hat sich bei uns gar nichts grundlegend verändert. Wir tätigen rund 40 Investments pro Jahr und konnten die Investitionsschlagzahl im Seed-Bereich durch alle Krisen aufrechterhalten. Das kommt zum Teil daher, dass wir selbst eine Art ‚Krisengeburt‘ erlebt haben – wir stammen ja aus der Dotcom-Ära, als im Anschluss kaum ein Investor noch in Technologie und Innovation investieren wollte und Venture Capital kaum bekannt war. Damals wurde der High-Tech Gründerfonds, auch über eine Initiative von Kanzler Schröder, gegründet, um Technologie in den Markt zu bringen – in Kooperation mit Partnern wie Bosch, Siemens und anderen – und damit marktkonform die Technologieinnovation zu fördern.
Diese Erfahrungen haben uns gelehrt, wie man Krisen bewältigen kann. Wir investieren also auch direkt in Krisenphasen. Wir wissen, wie man Unternehmen so aufbaut, dass sie schnell eine stabile Pipeline erreichen, eine ausreichende Runrate erzielen und im Fundraising gut vorbereitet sind. Seit der Corona-Phase und auch nach dem Ukraine-Konflikt waren die meisten unserer Portfoliounternehmen gut aufgestellt, weil sie wussten, dass sie ihren Runway verlängern und sich auf zusätzliche Herausforderungen im Fundraising einstellen müssen. Das hat dazu geführt, dass es nicht zu überraschend hohen Ausfällen kam und wir insgesamt sehr gut durch diese Phasen gekommen sind.
Natürlich hat sich in dieser Zeit durch das veränderte Zinsniveau auch die Fremdfinanzierung – die ja stark in Deep-Tech-Modelle einfließt – verändert. Hier wurden teilweise andere Finanzierungsprodukte, wie Corona-Fazilitäten und Fördermittel in Deutschland, genutzt. Insgesamt wurde die Mittelallokation in den Unternehmen sehr gut gesteuert. Man könnte sagen, dass wir in diesem Deep-Tech-Bereich antizyklisch agieren. Das Risiko ist zwar hoch – gerade, weil es sich oft um langfristige Finanzierungen handelt –, aber es ist wichtig, die Schlagzahl aufrechtzuerhalten, statt abzuwarten, bis alle wieder in den Markt wollen und bei extrem hohen Bewertungen einsteigen.
Zu den Investoren High-Tech-Gründerfonds zählen auch über 40 Corporates aus unterschiedlichsten Branchen. Wie nehmt ihr hier die Investitionsbereitschaft in Deep-Tech aktuell wahr?
Tanja Emmerling: Ja, ich glaube, dass gerade in der aktuellen Situation das Bewusstsein für den Erhalt der Binnenwirtschaft in Deutschland stark gewachsen ist. Unternehmen wollen ihre eigene IP halten und ihren Forschungsstandort sichern, um sich an den Industrien und den Innovationen zu orientieren – ohne zu sehr abhängig zu werden. Das Bewusstsein und die Offenheit für Innovationen ist also deutlich gewachsen, auch bedingt durch das Marktumfeld.
Andererseits beobachten wir, dass größere Konzerne in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit wieder stärker auf ihr Kerngeschäft setzen. Für unsere Portfoliounternehmen ist es deshalb wichtig, zu wissen, wie offen die Corporates für Kooperationen sind, wie schnell sie als Kunden agieren oder auch Zukäufe tätigen. Aktuell befinden sich viele in einer Warteposition, aber ich bin überzeugt, dass sich damit bald wieder ein neuer Impuls einstellt und die Bereitschaft in der deutschen Wirtschaft, also gerade im industriellen Bereich, deutlich steigt.
In Deep-Tech ist IP essenziell. Europa ist stark bei Patenten, aber schwach in der Kommerzialisierung. Was muss sich ändern, damit Europa im globalen Wettbewerb, besonders mit den USA, mithalten kann?
Tanja Emmerling: Ich glaube, dass ein grundlegendes Thema darin besteht, dass Forschungsinstitutionen oder Universitäten die Transformation von IPs in Unternehmen schneller vorantreiben müssen, damit diese direkt damit arbeiten können.
Es hat sich bereits viel getan, denn Universitäten zeigen heute eine deutlich größere Bereitschaft und haben ein besseres Verständnis dafür, wie ein Startup oder ein Spin-off funktioniert und was es braucht, um exitfähig zu werden.
Außerdem gibt es in Deutschland Initiativen, die darauf abzielen, mehr sogenannte Factory-Hubs zu schaffen, in denen Universitäten, lokale Wirtschaftsakteure und Startup-Initiativen zusammenarbeiten. Ein zentraler Baustein ist es, den klaren IP-Transfer in Unternehmen zu regeln. Zwar wird hier noch viel diskutiert – gerade weil Universitäten andere Anreizsysteme haben als Unternehmen – aber dies ist der Grundpfeiler, um weiterzukommen. Der Startup-Verband und die bestehenden Factories in Deutschland sorgen dafür, dass es durch standardisierte Prozesse und Verfahren mehr Klarheit gibt.
Laut EY Österreich hat Deutschland den Aufschwung bei Startup-Finanzierungen geschafft. Siehst du das auch so?
Tanja Emmerling: Ja und nein. Über das Jahr verteilt hat man den Eindruck, dass Gründungsinitiativen noch nicht in vollem Umfang zurückgekehrt sind. Ich hatte auch den EY-Bericht gelesen und war erstaunt, wie stark die Zahlen zum Jahresende angestiegen sind – was darauf hindeutet, dass die Gründungszahlen wieder zunehmen.
Das liegt vermutlich vor allem daran, dass viele Gründungen aus Forschungsinstitutionen stammen, insbesondere im Biotech-Bereich, der einen starken Aufwind erlebt. Zudem gibt es regionale Förderungen, bei denen Gründungsinitiativen aus den Universitäten hervorgehen und in regionale Hubs zurückfließen. Über das Jahr hinweg war das zwar nicht immer spürbar, aber die Zahlen zum Jahresende sprechen für einen Aufwärtstrend. Dennoch sehe ich, dass noch Potenzial vorhanden ist, das weiter ausgebaut werden muss. Ich bin aber optimistisch, dass insbesondere in der zweiten Jahreshälfte ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen sein wird.
Berlin gilt als die Startup-Hauptstadt. München gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung – aufgrund der starken Ausrichtung auf Deep-Tech. Wie siehst du diese Entwicklung?
Tanja Emmerling: Ich denke, dass in München vor allem die Nähe zu Industrieunternehmen eine große Rolle spielt, weil bestimmte große Player direkt vor Ort sind und die passenden Kundenprofile suchen. Außerdem hat sich das Unternehmertum in München sehr gut entwickelt. Berlin ist zwar international sehr attraktiv – unter anderem, weil hier oft günstigere Büroflächen und Mitarbeiter zu finden sind, was internationale Player anzieht –, dennoch zeigt sich in München ein konzentriertes Netzwerk mit einem anderen, sehr fokussierten Profil. Beide Städte haben ihre Stärken: In Berlin fließen, was die Größe betrifft, weiterhin viele Investoren, während München durch spezialisierte Netzwerkverbindungen und die Nähe zur Industrie besticht. Insgesamt ist Deutschland aber besonders diversifiziert – es gibt beispielsweise viele Hardware-Hubs in Aachen, spezialisierte Cluster in Leipzig oder Initiativen in NRW und im Ruhrgebiet.
Lass uns über Exits und Börsengänge sprechen. Seit 2005 hattet ihr 180 erfolgreiche Exits, darunter einige IPOs. In Europa hört man oft, dass das IPO-Fenster fehlt.
Tanja Emmerling: Wenn man sich das Sentiment in den USA anschaut, so scheint sich dort der IPO-Markt wieder zu öffnen. Für uns in Deutschland besteht die Herausforderung darin, dass es hier keinen wirklich funktionierenden IPO-Markt für Startups gibt. Es gibt zwar in den nordischen Ländern Ansätze, aber in Europa ist das IPO-Fenster für Startups bislang nicht attraktiv genug – es sei denn, man strebt direkt einen Börsengang in den USA an, was mit enormen Größenordnungen und hohen Kosten verbunden ist. Das ist ein Bereich, den wir konsequent weiterentwickeln müssen, damit auch in Europa eine Perspektive für Startups entsteht, indem der Börsen- und IPO-Markt breiter aufgestellt wird und auch kleinere Unternehmen Chancen haben.
Wie siehst du die Entwicklung bei Exits?
Tanja Emmerling: Ja, Exits finden statt, allerdings häufig in sehr spezialisierten Bereichen – zum Beispiel in der IT-Security oder ähnlichen Nischen. Diese Bereiche funktionieren nach wie vor sehr gut und erzielen solide Bewertungen. Aktuell justiert sich jedoch noch vieles, was die Marktentwicklung betrifft, und es gibt ein gewisses Zukauf-Sentiment, das sich abzeichnet.
Europa denkt wieder mehr über technologische Souveränität nach – auch wegen geopolitischer Entwicklungen wie Trump und dem Russland-Ukraine-Konflikt. Wie wirkt sich das auf den Deep-Tech-Bereich aus – auch in Hinblick auf Dual-Use-Technologien?
Tanja Emmerling: Ich denke, dass sich hier ein größerer Fokus auf Dual-Use-Technologien öffnet, um diese differenzierter zu betrachten. Es herrscht eine erhöhte Dringlichkeit, denn staatliche Institutionen setzen vermehrt auf die Digitalisierung und darauf, unabhängiger zu werden. Gleichzeitig wird die Wirtschaft gezielt gefördert, um den Innovationspfad nicht zu verlieren – es fließt mehr Geld in diese Bereiche, um die Industrie in Europa zu halten. Wie schnell und erfolgreich das umgesetzt wird, werden wir sehen. Vor allem aber hat auch der Mittelstand erkannt, dass jetzt der Moment ist, in den Innovationsbereich einzusteigen, mit Startups zusammenzuarbeiten, Kundenbeziehungen aufzubauen und spannende Cluster zu formen – etwa von Energie bis hin zu Sicherheitstechnologien.
In Europa rücken Regierungen nach rechts, und Klimaschutz ist nicht mehr überall Priorität. Wie beeinflusst das den Climate-Tech-Sektor? Hängt er stark von der Politik ab oder bleibt er wirtschaftlich trotzdem stabil?
Tanja Emmerling: Ich bin der Meinung, dass Climate-Tech aus wirtschaftlichen Gründen weiterhin Sinn macht und deshalb auch auf der Agenda bleibt – unabhängig von den politischen Schwankungen. Auch wenn die politischen Szenarien nicht ganz eindeutig sind, hat das Thema Energie nach wie vor hohe Priorität. Zudem eröffnet diese Unsicherheit auch neue alternative Ansätze, wodurch sich für Unternehmen im Climate-Tech-Bereich wieder neue Chancen ergeben.
Wie nimmst du aus Investorensicht den Deep-Tech-Markt in Österreich wahr?
Tanja Emmerling: Wir investieren etwa zu 30 Prozent im Ausland, vorwiegend innerhalb der EU. Die DACH Region ist natürlich ein sehr zentraler Baustein im Sourcing für uns. Gerne möchten wir auch noch mehr Unternehmen aus Österreich sehen, die auf den deutschen Markt gehen möchten.
0100 Conference DACH 2025 in Wien
Bald ist es wieder soweit: Vom 18. bis 20. Februar 2025 trifft sich die Elite der Private-Equity- und Venture-Capital-Branche in Wien zur elften Ausgabe der 0100 Conference DACH. Das Event ist einer der wichtigsten Treffpunkte für Investor:innen, Fondsmanager:innen und Branchenexpert:innen im deutschsprachigen Raum, um über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Investmentlandschaft zu diskutieren. Auch Tanja Emmerling wird als Speakerin auf der 0100 Conference auftreten.